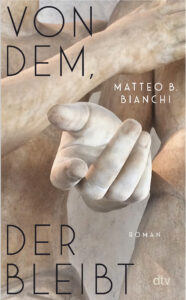Amelie Thoma studierte Romanistik und Kulturwissenschaften in Berlin und arbeitete zunächst als Lektorin. Seit 2017 ist sie als freie Übersetzerin aus dem Französischen und Italienischen für verschiedene Verlage tätig.
Mir ist Amelie Thoma erstmals als Übersetzerin von Leїla Slimani begegnet, deren Bücher ich stets mit großer Vorfreude erwarte. 2023 hat mich Amelie Thoma mit ihrer Begeisterung für die in Deutschland kaum bekannte provenzalische Schriftstellerin Maria Borrély (1890 – 1963) angesteckt, deren außergewöhnliche kleine Romane sie zufällig in ihrem langjährigen Urlaubsort Puimoisson im Département Alpes-de-Haute-Provence entdeckt hatte. In ihrer Neuübersetzung erschienen inzwischen im Kanon Verlag „Mistral“ (2023) und „Das letzte Feuer“ (2024). Zuletzt habe ich mit großer Freude den von ihr übersetzten Roman „Von dem, der bleibt“ (2024) des Italieners Matteo B. Bianchi gelesen.
Neben ihrer Arbeit als Übersetzerin ist Amelie Thoma auch als Moderatorin von Literaturveranstaltungen tätig.

Liebe Frau Thoma, wie kam es zu Ihrer Entdeckung der Schriftstellerin Maria Borrély und wie schwierig war es, einen Verlag für diese Autorin finden?
Ich habe das Buch zufällig in einer Bar im Ort entdeckt, in die wir hauptsächlich deshalb gingen, weil es dort W-lan gab. Der kulturinteressierte Wirt hatte eine Vitrine mit einigen Büchern eines kleinen regionalen Verlags aufgestellt, die mich natürlich sofort anzog. Hinter dem schlichten Taschenbuch erwartete ich bestenfalls eine nette, pittoreske Erzählung, deren Reiz vor allem darin bestand, dass sie in diesem Ort spielte. Stattdessen wurde ich von dem wundervollen, literarischen Text und der interessanten Geschichte seiner Autorin überrascht. Gunnar Cynybulk, der Kanon-Verleger, ließ sich erfreulicherweise sofort von meiner Begeisterung mitreißen und nahm die Autorin in sein kleines, erlesenes Programm auf.
Was ist für Sie das Besondere am Werk von Maria Borrély und wo liegen die besonderen Herausforderungen bei der Übertragung Romane ins Deutsche?
Das Besondere am Werk von Maria Borrély ist für mich die Sprache, in der sich ihre ganze Liebe für die Natur und die Menschen ausdrückt. Sie ist zugleich bäuerlich und poetisch, archaisch und modern, an manchen Stellen äußerst bildlich, dann wieder ganz knapp und trocken. Die Handlung lässt sich in drei Sätzen zusammenfassen, seine ganze Wirkung entfaltet der Text dank Maria Borrélys Schreibstil. Hinzu kommt, dass der Text durch die sparsame Erzählweise, die nicht viel Kontext liefert, und das zum Teil altmodische und ans Landleben geknüpfte Vokabular selbst für heutige französische Muttersprachler nicht immer leicht zu verstehen ist. Als ich das Original zum ersten Mal las, habe ich es daher mehr gefühlt als verstanden. Die Herausforderung war also, mir zunächst einmal den Inhalt zu erschließen, und ihn dann so ins Deutsche zu übertragen, dass er dort denselben Zauber entfaltet wie das französische Original.
Sie übersetzen Werke aus gleich zwei romanischen Sprachen, Französisch und Italienisch. Gibt es prinzipielle Unterschiede bei der Übersetzungsarbeit? Welche Besonderheiten der französischen bzw. italienischen Sprache funktionieren im Deutschen anders oder gar nicht?
Leider bin ich sehr schlecht darin, theoretische Aussagen über die Arbeit des Übersetzens zu treffen. (Linguistik war das Fach, das mir im Studium am wenigsten gefallen hat 🙂) Beiden Sprachen ist aber gemein, dass sie durch bestimmte Gerundiv- und Partizipialkonstruktionen im Satz eine Menge Informationen transportieren können, die im Deutschen oft zu schwerfälligen Nebensatzschachteleien führen. Ziel beim Übersetzen ist die berühmte „Wirkungsäquivalenz“, also dass der Text, siehe oben, beim Lesen auf Deutsch eine ähnliche Wirkung entfaltet wie beim Lesen auf Italienisch oder Französisch. Ich feile daher oft sehr lange am Satzbau, damit ein Text Deutschen ebenso mühelos dahinschnurrt wie im Französischen oder Italienischen. Eine weitere Schwierigkeit – aber das gilt für alle Sprachen, glaube ich – sind für mich emotionale Begriffe. Gerade das Französische hat da unglaubliche Schattierungen, für die wir im Deutschen oft keine genaue Entsprechung haben. Hier verbringe ich oft viel Zeit bei der Suche nach einem Synonym, das genau die passende Emotion ausdrückt.
Konzentrieren Sie sich jeweils auf eine Sprache oder können Sie zeitgleich an Projekten in beiden arbeiten?
Generell versuche ich immer nur an einem Projekt zu arbeiten. Natürlich kommt mal ein Rücklauf aus dem Lektorat oder ein Umbruch, während man schon an einer anderen Übersetzung sitzt, aber ich musste zum Glück noch nie zwei Übersetzungen parallel machen. Für mich ist entscheidend, dass ich mich auf den Ton eines Textes einschwingen kann, der ja nicht mein eigener ist. Ich muss mich sozusagen „verstellen“, so tun, als wäre ich die Autorin oder der Autor. Ist das erst einmal erreicht – meist nach einigen Dutzend Seiten –, geht das Übersetzen leichter von der Hand. Aber ich stelle es mir sehr schwierig vor, ständig zwischen zwei „Rollen“ hin und her zu wechseln.
Bei der Übersetzung von Vera Politkowskajas Sachbuch „Meine Mutter hätte es Krieg genannt“ aus dem Italienischen haben Sie mit Ihrem Kollegen Christian Försch zusammengearbeitet. Wie kann man sich gemeinsames Übersetzen vorstellen?
Im Falle eines Übersetzertandems muss man sich, um im obigen Bild zu bleiben, gemeinsam auf den Ton eines Textes einstimmen. Am Besten finde ich es daher, wenn eine*r anfängt zu übersetzen. Dann liest der oder die andere diesen Teil (ein paar Kapitel oder die Hälfte, je nachdem) erst einmal redigierend durch. Auf diese Weise stellt man sich aufeinander ein, bespricht Dinge, die man vielleicht anders machen würde. Dann übersetzt jede*r seine Kapitel unabhängig und anschließend redigiert man sich gegenseitig, bespricht offene Fragen, gleicht bestimmte Ausdrücke oder Szenen ab. Idealerweise gibt es zum Schluss noch eine Lektüre des Gesamtmanuskripts. Ich würde das nicht bei jedem Text machen wollen. Maria Borrélys Texte, zum Beispiel, erfordern zu viel kreativen Eigensinn. Andere Texte profitieren ganz klar von einem Tandem, und auch für die beiden Radler*innen ist der gegenseitige Austausch über einen Text bereichernd.
Italien war Gastland der Frankfurter Buchmesse 2024. Wie wirkte sich das im Vorfeld auf Übersetzungen aus dem Italienischen aus?
Der Gastlandauftritt sorgt eigentlich immer für eine Zunahme der Übersetzungen aus der jeweiligen Landessprache, da die Verlage auf Förderungen und vor allem auf eine verstärkte Aufmerksamkeit der Presse und des Publikums hoffen können. So war es auch dieses Jahr mit dem Gastland Italien. Leider gehen in der Flut dann auch viele schöne Titel unter.
Können Sie drei aktuelle oder klassische italienische Autorinnen oder Autoren nennen, die man nach dem Gastlandauftritt unbedingt lesen sollte?
Absolut empfehlen kann ich Igiaba Scegos „Kassandra in Mogadischu“ (übersetzt von Verena v. Koskull, erschienen bei Fischer), die packende autobiographische Geschichte ihrer auf der ganzen Welt verstreuten Somalischen Familie. Sehr neugierig bin ich auf Giulia Caminito, von der in Barbara Kleiner Übersetzung bei Wagenbach schon mehrere Titel auf Deutsch vorliegen, die ich aber selbst noch nicht gelesen habe. Und dann möchte ich natürlich den von mir übersetzten Autor Matteo B. Bianchi empfehlen, dessen wirklich besonderer, ebenfalls autobiographischer Text „Von dem, der bleibt“ über die Verarbeitung des Freitods seines Partners zwar nichts typisch Italienisches hat, aber Mut macht und die Augen öffnet.
Lehnen Sie Übersetzungsangebote ab, wenn Sie sich nicht für die Texte begeistern können?
Zum Glück haben mich bisher fast alle Texte begeistert, die ich übersetzt habe. Übersetzen ist jedoch bei aller Leidenschaft auch mein Brotberuf – also, ja, wenn ich die Wahl habe, picke ich mir natürlich Texte heraus, die mir zusagen, aber es kommt durchaus auch vor, dass ich etwas hauptsächlich übersetze, um mein Konto zu füttern.
Lesen Sie die zu übersetzenden Bücher, bevor Sie mit der Arbeit beginnen? Oder lassen Sie sich überraschen?
Das kommt darauf an, wie lang und wie literarisch sie sind. Meistens versuche ich sie vorher ganz zu lesen, aber zum Beispiel bei umfangreichen Krimis hält einen die Neugier auf die Auflösung ganz gut bei der Stange (auch Übersetzer*innen haben einen inneren Schweinehund 😉), da lasse ich mich dann gern überraschen.
Versuchen Sie, vor, während oder nach der Übersetzungsarbeit Kontakt zu den Autorinnen und Autoren aufzunehmen, soweit sie noch am Leben sind?
Auch das ist unterschiedlich. Je besser mir das Buch gefällt, desto eher. Es hängt auch von der Lektorin oder dem Lektor ab. Manche stellen den Autor*innen die verbleibenden Fragen lieber selbst, andere überlassen das gern den Übersetzer*innen.
Die Kunst des Übersetzens ist nicht nur eine mechanische Aufgabe, sie erfordert auch ein hohes Maß an Kreativität und Flexibilität. Wie finden Sie die Balance zwischen Texttreue, Anpassung kultureller Nuancen und dem Jonglieren mit verschiedenen Bedeutungen?
Auch das ist sehr schwer zu erklären, denn es ist ein Vorgang, der zugleich technisch und intuitiv ist. Es ist im Grunde ein behutsames Ausloten, ein Hin und Herschwingen zwischen Original und Übersetzung. Es geht, wie gesagt, leichter, sobald man sich auf einen Ton eingestimmt hat. Beim ersten Durchgang versuche ich so nah wie möglich am Original zu bleiben. Wenn ich mich vom Text wegbewege und dabei unsicher bin, ob es in die richtige Richtung geht oder ob ich vielleicht zu frei werde, oder wenn ich, im Gegenteil, das Gefühl habe, hier sollte ich noch eine freiere Lösung finden, die im Deutschen besser klingt, füge ich einen Kommentar ein (diese wunderbaren Sprechblasen). Dieser enthält dann meist die Originalstelle, damit ich nicht ewig suchen muss, und oft meine möglichen alternativen Ideen. Idealerweise entsteht so eine Rohfassung, die alle wesentlichen Elemente des Originals enthält. In zwei bis drei weiteren Durchgängen schwimme ich mich dann frei vom Original, bis alle Anmerkungen und Alternativen verschwunden sind und – hoffentlich – ein in sich runder, stimmiger deutscher Text entstanden ist, von dem ich der Meinung bin, dass er bei den Lesenden annähernd dieselbe Wirkung erzielt wie das Original. Das erfordert gleichermaßen Frechheit wie Demut. Man darf jedenfalls nicht nach unten schauen, während man sich auf diesem Drahtseil vorantastet.
Nur sehr wenige Verlage nennen die Übersetzerinnen und Übersetzer auf dem Cover. Wird nach Ihrer Ansicht den Übersetzerinnen und Übersetzern literarischer Werke zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Was würden Sie sich wünschen?
Neulich las ich mal wieder eine Kritik zu einem übersetzten Text, in der die sehr besondere Sprache der Autorin oder des Autors ausführlich gelobt, der oder die Übersetzer*in aber nicht mal bei den bibliographischen Angaben erwähnt wurde. So etwas ärgert mich sehr. Denn nur der Übersetzerin oder dem Übersetzer ist es zu verdanken, dass man diese so besondere Sprache „auf Deutsch“ genießen kann. Wegen mir müssen wir nicht auf dem Cover stehen, aber ich würde mir wünschen, dass unsere wertvolle Arbeit von den Profis der Buchbranche mehr beachtet und ins Bewusstsein der Lesenden gerückt wird.
In Zeiten von KI kann eine Frage nach ihrer Nutzung im Bereich literarischer Übersetzungen nicht fehlen. Nutzen Sie KI für Ihre Arbeit? Sehen Sie Ihren Beruf langfristig in Gefahr?
O weh, eine schwierige und komplexe Frage. Ich nutze natürlich Online-Wörterbücher und gebe auch mal Wortkombinationen oder Sätze bei Google oder bei Reverso ein. Mir ist übrigens schleierhaft, wie Menschen übersetzen konnten, bevor es das Internet gab – auch zur Recherche nutze ich es unablässig. KI nutze ich jedoch überhaupt nicht. Nicht mal aus Spielerei, weil ich damit einfach nichts zu tun haben möchte. Als ehemalige Lektorin weiß ich, wie sehr eine schlechte Lösung der eignen Kreativität, dem eigenen Erschließen eines Textes im Weg stehen kann. Ein vom Deutschen Übersetzerfonds finanziertes Rechercheprojekt hat übriges genau dies ergeben. Ich bin mir auch ganz sicher, dass keine KI jemals das erschaffen kann, was ich für eine gute literarische Übersetzung halte. Allerdings fürchte ich, dass sich unser Sprachempfinden den maschinengenerierten Texten anpassen wird, und irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht niemand mehr so eine teure, mühsam von Menschen erschaffene Übersetzung bezahlen wird. Allerdings habe ich keine Lust, mir davon jetzt schon in vorauseilendem Gehorsam die Laune verderben zu lassen, sondern freue mich noch lieber an den vielen tollen großen und kleinen Verlagen und Buchhandlungen, interessierten und begeisterten Lesenden und sonstigen Literatur- und Sprachverliebten wie Sie und ich, die diesem Land ein sehr reiches literarisches Leben bescheren.
Was sind Ihre nächsten Projekte?
Lauter tolle Texte: Leïla Slimanis neuer Roman „J’emporterai le feu“, der großartige dritte Teil ihrer Familientrilogie. Philippe Collins „Le Barman du Ritz“, ein aufregender, auf Tatsachen beruhender Roman im von den Deutschen okkupierten Paris. „Nous“, ein neues Jugendbuch von Christelle Dabos, Autorin der wundervollen Spiegelreisenden-Saga.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit!
Und Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr Engagement!
Rezensionen zu Büchern in der Übersetzung von Amelie Thoma auf diesem Blog:
Hier geht es zu weiteren Interviews mit Übersetzerinnen und Übersetzern.