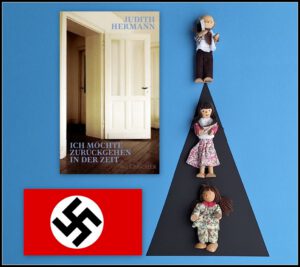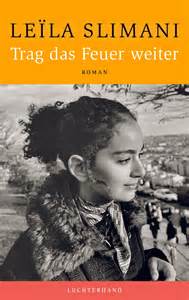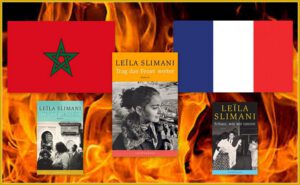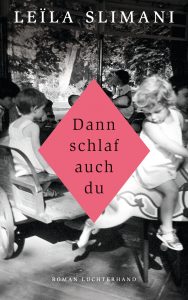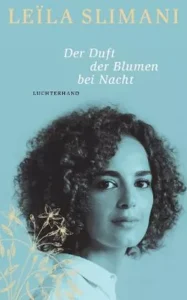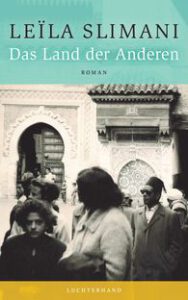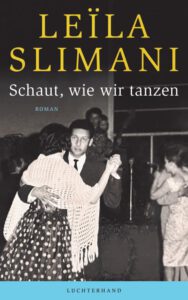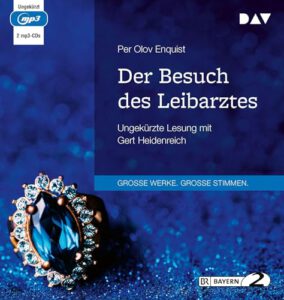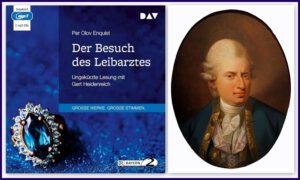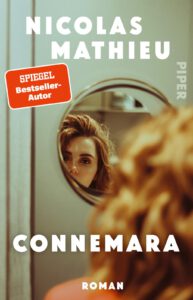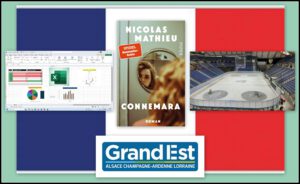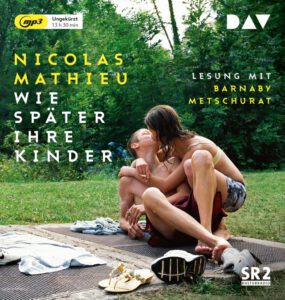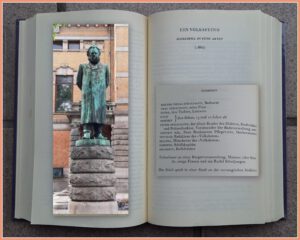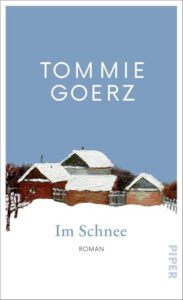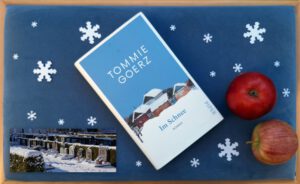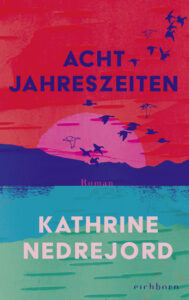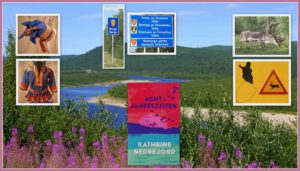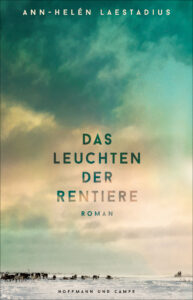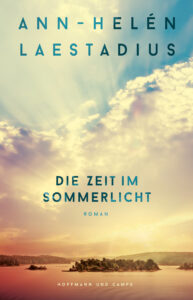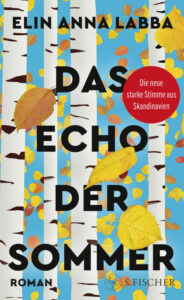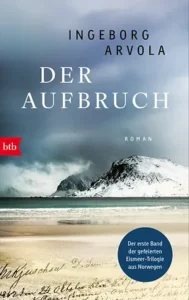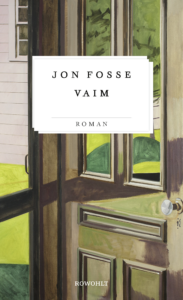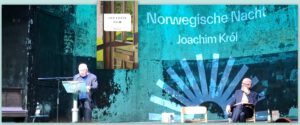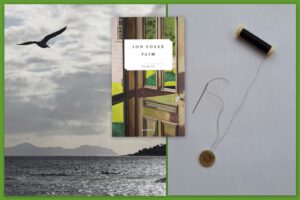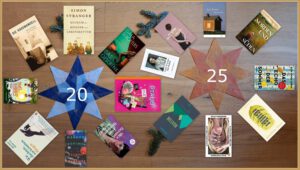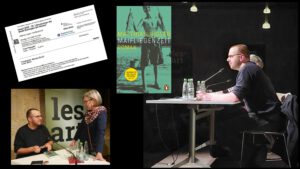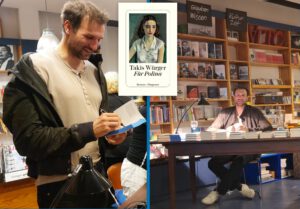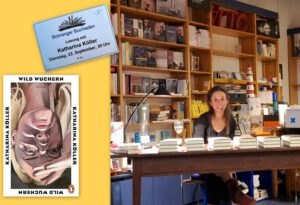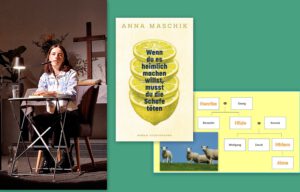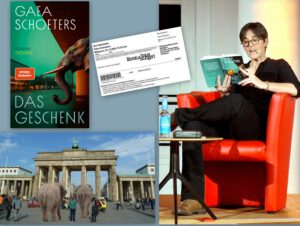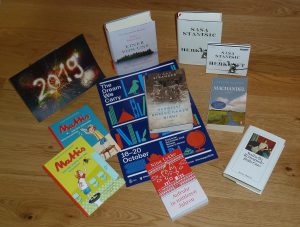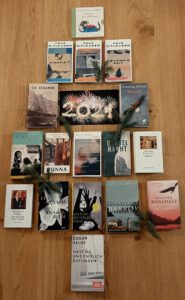Zwei Welten
Zwei Welten
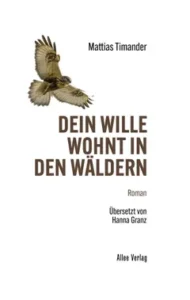
Im Roman Der Aufbruch von Ingeborg Arvola habe ich die Volksgruppe der Kvenen kennengelernt, finnische Einwanderer in die norwegische Finnmark. Der 1998 im nordschwedischen Kiruna geborene Autor Mattias Timander ist dagegen Tornedaler, benannt nach dem schwedisch-finnischen Grenzfluss Torneälv, der in den Bottnischen Meerbusen mündet. Ursprünglich Finnen, wurden sie durch Grenzverlegung im schwedisch-russischen Krieg von 1808/09 zu Schweden. Sowohl die norwegischen Kvenen als auch die schwedischen Tornedaler sind eigenständige ethnische Minderheiten.
Klang und Rhythmus
Dem 2024 gegründeten unabhängigen Allee Verlag, der sich für literarische Stimmen aus unterrepräsentierten europäischen Sprachen einsetzt, und der Übersetzerin Hanna Granz ist es zu verdanken, dass der in seinem Heimatland preisgekrönte Debütroman von Mattias Timander, Dein Wille wohnt in den Wäldern, nun auf Deutsch vorliegt. Völlig zurecht wird die Übersetzerin für ihre eindrucksvolle Arbeit auf dem Einband genannt. Einerseits ist der Originaltext sprachlich geprägt durch den nordschwedischen und den tornedalischen Dialekt sowie die Minderheitensprache Meänkieli, auch Tornedalfinnisch genannt. Andererseits musste sie eine Entsprechung für den speziellen Ton und die Melodie des jungen Ich-Erzählers finden. Ohne den unbefriedigenden Umweg über eine deutsche Mundart ist ihr dieser ganz eigene Klang so gut gelungen, dass man von Beginn an sanft in den Rhythmus der Sprache gleitet.
Ein Suchender
Der in Kiruna aufgewachsene, offenbar seit Kurzem verwaiste Ich-Erzähler hat nach dem Abitur die Ferienhütte der Familie in dem nordschwedischen Dorf bezogen, aus dem seine Eltern stammen, umgeben von Wald und Bergen. Es ist ein bewusster Rückzug und ein Versuch, tief in der Natur Orientierung zu finden:
Wahrscheinlich steckte auch was wie Angst dahinter, dass ich im Dorf gelandet bin. Während der Schulzeit hatte ich in der Stadt nie meine Ruhe, in dieser nervösen Horde, die um jeden Preis zusammengehalten werden musste und zu der ich nie richtig gehörte. (S.15)
Seine einzigen Kontakte sind alte Dorfbewohnerinnen und -bewohner wie der etwa 70-jährige Handwerker und Bootsbesitzer Tage und die noch ältere Viola, die stets Kaffee, Kuchen und einen Platz zum Ausruhen auf ihrer Küchenbank bereithält. Nicht nur der Ich-Erzähler ist wortkarg, auch die Menschen im Dorf beantworten seine Fragen zur Geschichte, ethnischen Wurzeln und uralten Fehden höchstens mit Anekdoten.
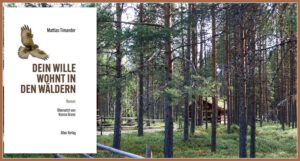
Kaum hat er einen Rhythmus aus körperlicher Arbeit und Ruhe für seinen neuen Alltag gefunden, stellt der Fund zunächst eines Buches, späterer weiterer, sein Leben auf den Kopf:
Dann ging es richtig los, ich las wie ein Verrückter. […] Ich fing an nachzudenken, vielleicht auch darüber, ob ich wirklich hierhergehörte oder ob es da unten vielleicht noch was anderes geben könnte. Ich phantasierte plötzlich von der Großstadt, träumte und romantisierte, wie es wäre, einen anderen Sinnzusammenhang zu finden. (S. 37)
Wandel durch Aufbruch
Abrupt bricht er mitten im bitterkalten Winter auf nach Stockholm, taucht ein in die Literatur, findet Zugang zur Kulturszene, erhält Schreib- und Interviewaufträge, sammelt manisch Bücher, verliebt sich unglücklich und lebt als Bohemien, bis er merkt, dass er auch hier nicht hingehört. Ein Anruf von Viola ruft ihn zurück:
Wenn ich das Erbe nicht antrat, wer dann. Wenn ich mich nicht um das Schicksal des Landes hier kümmerte, wer dann. (S. 160)
Dein Wille wohnt in den Wäldern ist ein ruhig erzählter, sehr feinfühliger Roman mit einer ungewöhnlichen, melancholisch grundierten Erzählstimme und fantastischen Naturbeschreibungen. Unvergesslich bleibt der sympathische junge Ich-Erzähler mit seiner Suche nach Herkunft, Zugehörigkeit, Orientierung und dem Sinn des Lebens, der sich weder von Rückschlägen noch von Sackgassen entmutigen lässt.
Eine bemerkenswerte neue Stimme und ein ebenso ungewöhnliches wie empfehlenswertes Leseerlebnis.
Mattias Timander: Dein Wille wohnt in den Wäldern. Übersetzt von Hanna Granz. Allee Verlag 2025
allee-verlag.de