![]() Leben Nummer zwei oder Glück ist kein Zustand
Leben Nummer zwei oder Glück ist kein Zustand
 Meret ist vierzig, hat mit Dres einen familienfreundlichen, zupackenden Mann, der sie liebt, und zwei aufgeweckte Jungs von drei und vier Jahren. Finanziell ist die Familie gut gestellt, objektiv sind alle Voraussetzungen für ein glückliches Familienleben gegeben, und doch fühlt sich Meret seit der Geburt des zweiten Kindes verzagt, ausgelaugt, überfordert, verkraftet die Verantwortung nicht und fühlt sich so in Anspruch genommen, dass sie keine eigenen Bedürfnisse mehr hat. Sie leidet darunter, kein eigenes, unabhängiges Leben mehr zu haben und den alleinigen Preis für die Familie zu bezahlen.
Meret ist vierzig, hat mit Dres einen familienfreundlichen, zupackenden Mann, der sie liebt, und zwei aufgeweckte Jungs von drei und vier Jahren. Finanziell ist die Familie gut gestellt, objektiv sind alle Voraussetzungen für ein glückliches Familienleben gegeben, und doch fühlt sich Meret seit der Geburt des zweiten Kindes verzagt, ausgelaugt, überfordert, verkraftet die Verantwortung nicht und fühlt sich so in Anspruch genommen, dass sie keine eigenen Bedürfnisse mehr hat. Sie leidet darunter, kein eigenes, unabhängiges Leben mehr zu haben und den alleinigen Preis für die Familie zu bezahlen.
Während des Standurlaubs im italienischen Spotorno bei glühender Hitze trifft sie Jan, einen schwedischen Expat, der mit seiner Frau Romy und den beiden kleinen Söhnen in Zürich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft wohnt. Jan und Romy sind Weltenbummler, heute hier morgen dort, und an jedem Ort erfindet sich Romy neu. In ihrem Blog schafft sie sich ein Leben, wie sie es gerne führen würde. Jan dagegen ist beruflich erfolgreich, reist durch die Welt und trainiert intensiv Marathon.
Ein Jahr umfasst die Zeitspanne des Romans, der aus einem Brief von Meret an Jan besteht, und in dem wir nicht erfahren, ob die geschildert Beziehung Realität oder Fantasie ist. Ich habe mich manchmal gefragt, ob der Roman Eine Frau von vierzig Jahren von Vita Sackwell-West, den Meret zu Beginn liest, und in dem eine vierzigjährige Witwe aus ihrem inhaltsleeren Alltag ausbricht und sich unkonventionell verliebt, der Auslöser für Merets tatsächlichen oder erträumten Ehebruch ist. Auf jeden Fall ist die Affäre von Anfang an zum Scheitern verurteilt, denn „wir hängen zu acht drin“. Für Meret ist es eine Rückkehr in die Zeit vor Dres und den Kindern: „… wir waren nicht mehr Vater, Mutter oder Ehepartner, wir waren wieder diejenigen, die wir gewesen waren, bevor das Leben so viele Forderungen an uns gestellt hatte.“
Als Meret nach einem Jahr nach Sotorno zurückkehrt, ist sie eine andere, das hat mich neben dem wunderbaren Stil der Autorin besonders begeistert. Obwohl mir keine der Figuren des Vier-Personen-Stücks sympathisch war und ich mich, vielleicht weil ich fast eine Generation älter bin, absolut nicht in sie hineinversetzen konnte, hat mich der Roman von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt. Die strickte Ich-Perspektive verhindert es, die Gedanken der anderen drei Beteiligten zu erfahren, was für mich einen zusätzlichen Reiz ausmacht. Die Stimmung (nicht der Inhalt) des Romans und das Lebensgefühl der Dreißig- bis Vierzigjährigen hat mich an Die Glücklichen von Kristine Bilkau erinnert, ein Buch, das ich mit der gleichen Faszination gelesen haben.
Unnötig fand ich den titelgebenden, häppchenweise eingestreuten Bericht einer Bekannten von Meret über deren Affäre mit einem Mannschaftsoffizier während einer Kreuzfahrt. Was mir dagegen ausgesprochen gut gefällt, ist die Umschlaggestaltung mit den vier im Meer treibenden, nach den Protagonisten benannten Inseln. Die Verbindungen zwischen ihnen kommen wunderbar zur Geltung und ich habe sie mir beim Lesen immer wieder angeschaut. Außerdem liegt das Buch dank des etwas kleineren Formats sehr gut in der Hand und wirkt mit dem Lesebändchen hochwertig.
Für mich ist die Autorin Mireille Zindel eine Entdeckung und ich freue mich auf weitere Romane von ihr!
Mireille Zindel: Kreuzfahrt. Kein & Aber 2016
keinundaber.ch

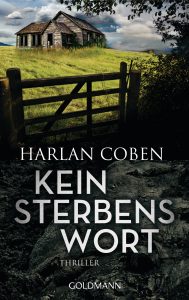
 Michel Bussi, Geograf und Politologe an der Universität von Rouen, ist inzwischen ein vielprämierter Autor. Seine Bücher fallen bei mir in die Gattung „Hängematte“, was bedeutet, dass ich stilistisch keine allzu großen Höhenflüge erwarte, aber spannend und gekonnt unterhalten werden will.
Michel Bussi, Geograf und Politologe an der Universität von Rouen, ist inzwischen ein vielprämierter Autor. Seine Bücher fallen bei mir in die Gattung „Hängematte“, was bedeutet, dass ich stilistisch keine allzu großen Höhenflüge erwarte, aber spannend und gekonnt unterhalten werden will.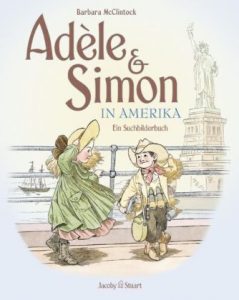 Dieses nostalgische Bilderbuch spielt während einer USA-Reise der Geschwister Adèle und Simon mit ihrer Tante Cécile zu Beginn es 20. Jahrhunderts. Zuerst werden die Koffer gepackt und alle mitgenommenen Gegenstände sind gut zu erkennen. Dann geht es los. Doch leider verliert der schusselige Simon an jedem Ort einen Gegenstand. In New York, Boston, Chicago, North Dakota, Washington, San Francisco, Denver, Santa Fee, Lubbock, New Orleans und St. Louis, die man alle auf der Karte finden kann, bleibt jeweils ein Gegenstand zurück, den es zu finden gilt.
Dieses nostalgische Bilderbuch spielt während einer USA-Reise der Geschwister Adèle und Simon mit ihrer Tante Cécile zu Beginn es 20. Jahrhunderts. Zuerst werden die Koffer gepackt und alle mitgenommenen Gegenstände sind gut zu erkennen. Dann geht es los. Doch leider verliert der schusselige Simon an jedem Ort einen Gegenstand. In New York, Boston, Chicago, North Dakota, Washington, San Francisco, Denver, Santa Fee, Lubbock, New Orleans und St. Louis, die man alle auf der Karte finden kann, bleibt jeweils ein Gegenstand zurück, den es zu finden gilt.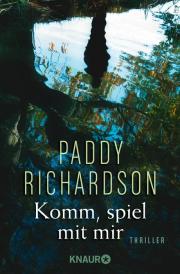 Der zweite Krimi der Neuseeländerin Paddy Richardson, Komm, spiel mit mir, stand in Neuseeland wochenlang auf Platz 1 der Bestsellerliste und konnte mich deutlich mehr überzeugen als ihr erster, Der Frauenfänger.
Der zweite Krimi der Neuseeländerin Paddy Richardson, Komm, spiel mit mir, stand in Neuseeland wochenlang auf Platz 1 der Bestsellerliste und konnte mich deutlich mehr überzeugen als ihr erster, Der Frauenfänger.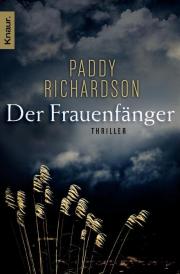 Dieser erste Krimi der Neuseeländerin Paddy Richardson erschien bereits früher unter dem Titel Der Vogelbrunnen. Laut Klappentext handelt es sich um einen Thriller, für mich ist es eher ein psychologischer Krimi.
Dieser erste Krimi der Neuseeländerin Paddy Richardson erschien bereits früher unter dem Titel Der Vogelbrunnen. Laut Klappentext handelt es sich um einen Thriller, für mich ist es eher ein psychologischer Krimi.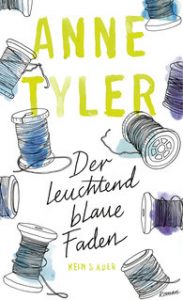 Anne Tyler, geboren 1941, lebt in Baltimore, dem Handlungsort ihres 20. Romans, Der leuchtend blaue Faden, der 2015 auf der Bestenliste für den Man Booker Preis stand. Auch er handelt von ihrem bevorzugten Sujet: der Familie.
Anne Tyler, geboren 1941, lebt in Baltimore, dem Handlungsort ihres 20. Romans, Der leuchtend blaue Faden, der 2015 auf der Bestenliste für den Man Booker Preis stand. Auch er handelt von ihrem bevorzugten Sujet: der Familie.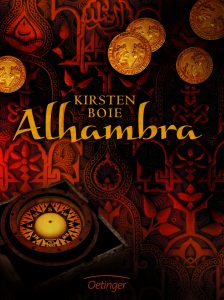 Kirsten Boie ist für mich eine der größten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen der Gegenwart, vielleicht sogar die größte. Besonders beeindruckt mich immer wieder, dass sie für alle Altersklassen schreiben kann, vom Bilderbuch bis zum älteren Jugendlichen, und welch großes Themenspektrum sie abdeckt.
Kirsten Boie ist für mich eine der größten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen der Gegenwart, vielleicht sogar die größte. Besonders beeindruckt mich immer wieder, dass sie für alle Altersklassen schreiben kann, vom Bilderbuch bis zum älteren Jugendlichen, und welch großes Themenspektrum sie abdeckt.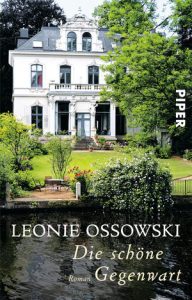 Nele Ungureit, 69 Jahre alt, steht über Nacht vor den Scherben ihrer Ehe. Nach über 40 gemeinsamen Jahren, in denen sie mit ihrem Mann Fred ein großes Möbelhaus aufgebaut hat, wendet der sich einer jüngeren Angestellten zu, die nahtlos Neles Platz in Beruf und Haus einnimmt.
Nele Ungureit, 69 Jahre alt, steht über Nacht vor den Scherben ihrer Ehe. Nach über 40 gemeinsamen Jahren, in denen sie mit ihrem Mann Fred ein großes Möbelhaus aufgebaut hat, wendet der sich einer jüngeren Angestellten zu, die nahtlos Neles Platz in Beruf und Haus einnimmt.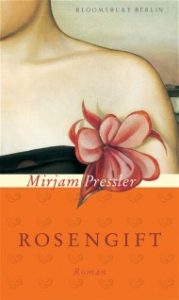 In dieser raffinierten Mischung aus Krimi, Liebesroman und Psychogramm gerät das perfekt organisierte Singledasein der erfolgreichen und selbstbewussten Krimiautorin Lisa Bratt völlig aus dem Gleichgewicht. Ein obdachloses, alkoholkrankes Mädchen, das sie gegen besseres Wissen bei sich aufnimmt, und ein neuer Geliebter, für den sie sogar ihre Unabhängigkeit aufgeben könnte, bringen sie so weit, dass sie am Ende nur noch die Notbremse ziehen kann…
In dieser raffinierten Mischung aus Krimi, Liebesroman und Psychogramm gerät das perfekt organisierte Singledasein der erfolgreichen und selbstbewussten Krimiautorin Lisa Bratt völlig aus dem Gleichgewicht. Ein obdachloses, alkoholkrankes Mädchen, das sie gegen besseres Wissen bei sich aufnimmt, und ein neuer Geliebter, für den sie sogar ihre Unabhängigkeit aufgeben könnte, bringen sie so weit, dass sie am Ende nur noch die Notbremse ziehen kann…