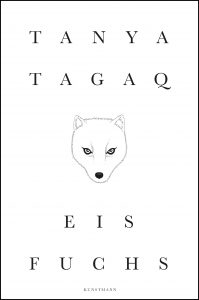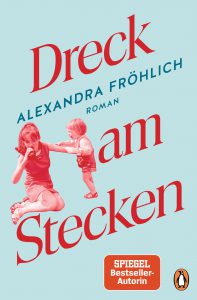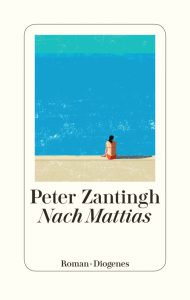Ein preisgekröntes Entdecker-Bilderbuch
Ein preisgekröntes Entdecker-Bilderbuch
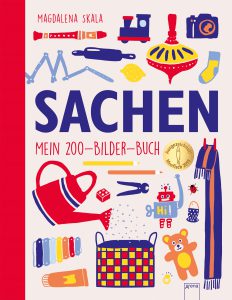
Den Bilderbuchillustrationspreis „Der Meefisch“, hochdeutsch: „Der Mainfisch“, habe ich erst vor Kurzem kennengelernt. Er wird jedoch bereits seit 2005 alle zwei Jahre von der Stadt Marktheidenfeld am Main für ein unveröffentlichtes Bilderbuchprojekt vergeben. Die ausgezeichnete Vorlage wird seit dem Preisjahr 2009 im Würzburger Kinder- und Jugendbuchverlag Arena veröffentlicht, der Gewinner oder die Gewinnerin erhält zusätzlich ein Preisgeld von 2000 Euro. Begleitend findet eine Ausstellung der 18 besten Beiträge im Kulturzentrum Franck-Haus in Marktheidenfeld statt, während der die Besucherinnen und Besucher ein Werk mit einem eigenen, mit 500 Euro dotierten Publikumspreis auszeichnen.
Meefisch-Preisträgerin 2019 unter über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde die Grafikdesign-Studentin Magdalena Skala. Ihr Bilderbuch Sachen. Mein 200-Bilder-Buch hat nicht nur die Fachjury, sondern auch mich mit seinen klaren Illustrationen und den leuchtenden Farben Blau, Gelb, Rot und Orange überzeugt. Auf acht glänzenden Doppelseiten aus Pappe mit abgerundeten Ecken sind – geordnet nach den Räumen eines Hauses – Alltagsgegenstände aus Garderobe, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, Speisekammer, Bad, Keller und Waschküche abgebildet, auf weiteren zwei Doppelseiten Gartenutensilien sowie Bauernhoftiere.
Die Perspektive ist jeweils so günstig gewählt, dass die Gegenstände gut erkennbar sind, allerdings braucht es wegen der Beschränkung der Farben trotzdem Fantasie, denn die Katze ist rot, der Kaktus blau und das Brot zitronengelb. Anspruchsvoll ist die Doppelseite mit der Speisekammer, besonders einfach und auch für ganz kleine Betrachterinnen und Betrachter zu benennen sind demgegenüber die Gegenstände in der Waschküche und die Tiere.
Pfiffig ist die Idee, auf jeder Doppelseite einen kleinen Marienkäfer zu verstecken, mal krabbelnd, mal fliegend oder als Dekoration, der nicht immer leicht zu finden ist. Man muss also schon genau hinsehen bei diesem Bilderbuch ohne Text, bei dem es für Kinder ab eineinhalb Jahren jede Menge zu entdecken und zu erzählen gibt.
Magdalena Skala: Sachen. Mein 200-Bilder-Buch. Arena 2020
www.arena-verlag.de

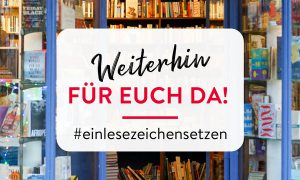
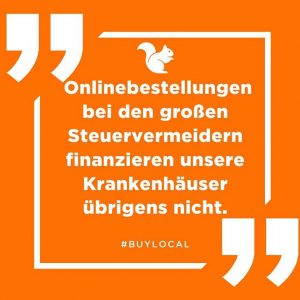
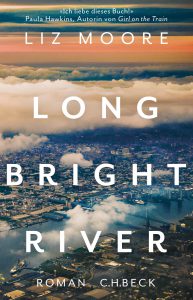
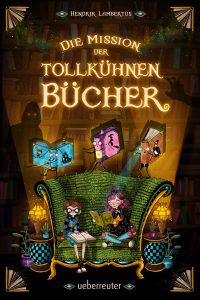
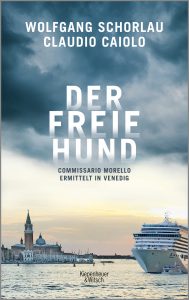
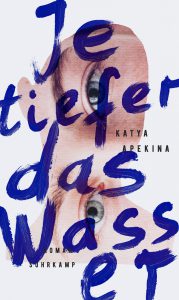 Zwölf Jahre haben Edith und Mae nichts von ihrem Vater Dennis Lomack gehört, als er sie nach dem Selbstmordversuch ihrer Mutter Marianne von New Orleans nach New York holt. Die 14-jährige Mae begrüßt die Befreiung aus der Umklammerung ihrer psychisch kranken Mutter und hofft auf einen Neuanfang bei ihrem fremden Vater, einem gefeierten Schriftsteller. Ganz anders die 16-jährige Edith, die noch weiß, wie der Vater nach Mariannes erstem Suizidversuch die Familie verließ. Sie misstraut ihm, gibt ihm die Schuld am Leiden der Mutter und wirft ihm vor, seine Töchter damit alleine gelassen zu haben. Nun fühlt sie sich vom Vater gekidnappt und möchte so schnell wie möglich zu ihren Freunden, vor allem aber aus Verantwortungsbewusstsein zu ihrer Mutter zurück. Als der Vater dies ablehnt, macht sie sich heimlich auf den Weg und lässt Mae allein bei ihm zurück. Für beide Schwestern nimmt das Verhängnis seinen Lauf.
Zwölf Jahre haben Edith und Mae nichts von ihrem Vater Dennis Lomack gehört, als er sie nach dem Selbstmordversuch ihrer Mutter Marianne von New Orleans nach New York holt. Die 14-jährige Mae begrüßt die Befreiung aus der Umklammerung ihrer psychisch kranken Mutter und hofft auf einen Neuanfang bei ihrem fremden Vater, einem gefeierten Schriftsteller. Ganz anders die 16-jährige Edith, die noch weiß, wie der Vater nach Mariannes erstem Suizidversuch die Familie verließ. Sie misstraut ihm, gibt ihm die Schuld am Leiden der Mutter und wirft ihm vor, seine Töchter damit alleine gelassen zu haben. Nun fühlt sie sich vom Vater gekidnappt und möchte so schnell wie möglich zu ihren Freunden, vor allem aber aus Verantwortungsbewusstsein zu ihrer Mutter zurück. Als der Vater dies ablehnt, macht sie sich heimlich auf den Weg und lässt Mae allein bei ihm zurück. Für beide Schwestern nimmt das Verhängnis seinen Lauf.