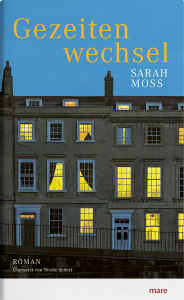![]() Held wider Willen
Held wider Willen
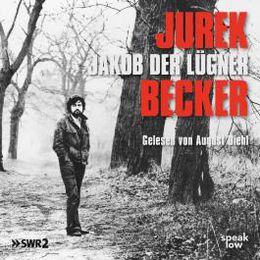
Um die Geschichte des Juden und Ghettobewohners Jakob Heym nicht dem Vergessen anheimfallen zu lassen, erzählt sie ein anonymer Überlebender des Holocaust. Er wählt dafür meist die auktoriale Erzählform, streut aber auch Passagen aus der Ich-Perspektive ein. „Das meiste“ weiß er aus erster Hand vom toten Jakob selbst, manches von Zeitzeugen, und wo sich diese nicht finden ließen, füllt er die Lücken. Jakob ist für ihn ein Held, einer der zwar immer Angst hatte, der jedoch unglaublich mutig war. Angeregt zu diesem Roman hat den Autor Jurek Becker, der selbst, wie er sagte, keine Erinnerung an seine Kindheit im Ghetto von Łódź und in verschiedenen KZs hatte, eine wahre Geschichte.
Jakob Heym, ehemaliger Besitzer einer bescheidenen Restauration, lebt in einem namenlosen Ghetto im Osten. Der Zweite Weltkrieg neigt sich bereits dem Ende zu, doch sind die Bewohner des Ghettos von jeglichem Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten und ohne Information über das Kriegsgeschehen. Die Lage ist verzweifelt, Hungertote und Selbstmorde bestimmen den Alltag. Da hört Jakob zufällig im Radio der Polizeistation, dass die Russen bereits fast bis Besanika vorgerückt sind. Seine Quelle kann er unmöglich nennen, hat doch vor ihm noch niemand die Polizeistation lebend wieder verlassen, doch gibt er die Meldung seinem Arbeitskollegen Mischa weiter, um ihn vom lebensgefährlichen Kartoffelraub abzulenken. Damit ist die Nachricht in der Welt und Jakob kann sie nicht mehr zurückholen. Da er als Quelle ein eigenes, verstecktes Radio angibt, werden er und das Gerät zum Mittelpunkt allen Denkens im Ghetto. Die allgemeine Verzweiflung schlägt in Hoffnung um, plötzlich scheint das Überleben eine reale Option und die Selbstmordrate sinkt auf null. Während die Menschen im Ghetto Pläne für eine nun plötzlich greifbar erscheinende Zukunft schmieden, wird die Situation für Jakob immer schwieriger, denn mit der einmaligen Neuigkeit ist es nicht getan. Gleichzeitig fühlen sich einige von dem verbotenen Gerät bedroht, andere werden zunehmend leichtsinniger. Jakob muss entscheiden, wie es nach der ungewollten Lüge weitergeht.
Jakob der Lügner, der 1969 erschienene Debütroman von Jurek Becker (vermutlich 1937 – 1997) ist eines der Bücher, die schon viel zu lang auf meiner Wunschliste stehen. Nun hat sich mit dieser erstmals ungekürzten Hörfassung als Koproduktion von speak low und der SWR 2 Literaturredaktion eine Alternative geboten, die ich sehr gerne ergriffen habe. Der Sprecher August Diehl liest den Text angenehm zurückhaltend und doch an den entscheidenden Stellen mit großer Wucht. Er interpretiert die tieftraurigen Stellen genauso bewegend wie die tragikomischen und ist für mich in den 515 Hörminuten vollkommen mit der Figur des Ich-Erzählers verschmolzen.
Sehr gut gefallen haben mir auch die Box, die mit Zitaten bedruckten Hüllen der sieben CDs und das informative Booklet mit einem Text des Autors über seine fehlenden Erinnerungen und einem Aufsatz von Christine Becker zur Entstehungsgeschichte des Romans.
Jurek Becker: Jakob der Lügner / Gelesen von August Diehl. Speak low 2016
www.speaklow.de

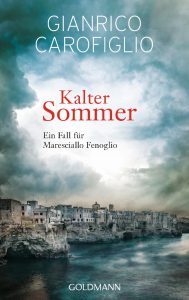
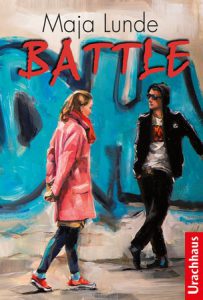
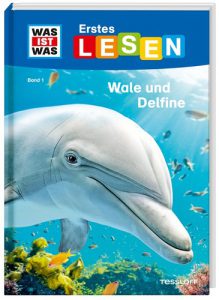
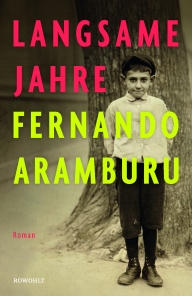
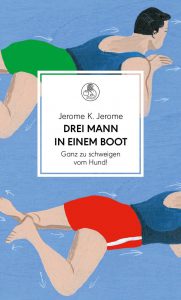
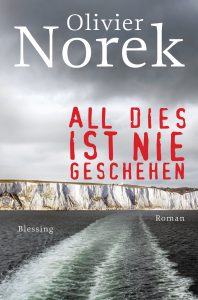
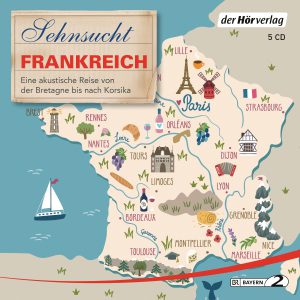
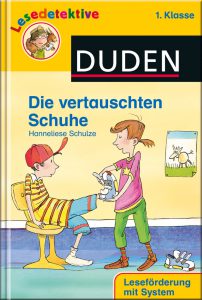 Lesedetektive heißt die Erstleserreihe aus dem Duden Verlag, bei der die beiliegenden Lesezeichen als Lösungsschlüssel für die eingestreuten kleinen Quizfragen dienen. Die Bände der Reihe sind nach Klassen unterteilt. Ich selbst bevorzuge eine Einteilung in verschlüsselte Lesestufen, da man schlechten Leserinnen und Lesern so auch ein Buch für eine niedrigere Stufe in die Hand geben kann, ohne sie damit zu beschämen.
Lesedetektive heißt die Erstleserreihe aus dem Duden Verlag, bei der die beiliegenden Lesezeichen als Lösungsschlüssel für die eingestreuten kleinen Quizfragen dienen. Die Bände der Reihe sind nach Klassen unterteilt. Ich selbst bevorzuge eine Einteilung in verschlüsselte Lesestufen, da man schlechten Leserinnen und Lesern so auch ein Buch für eine niedrigere Stufe in die Hand geben kann, ohne sie damit zu beschämen.