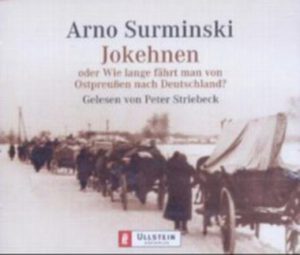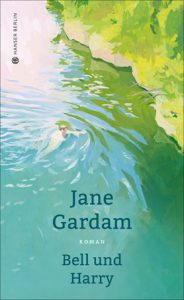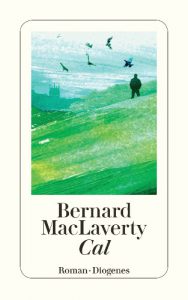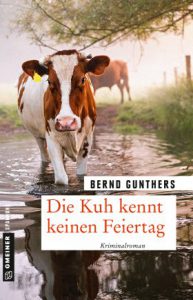![]() Kein Ostsee-Bullerbü
Kein Ostsee-Bullerbü
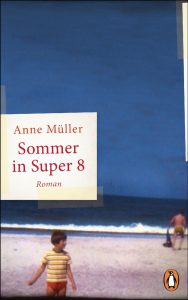
Das Cover zu Anne Müllers Debütroman Sommer in Super 8 passt wunderbar zu dieser Geschichte über eine Kindheit in Schleswig-Holstein während der 1970er-Jahren. Eine Strandszene, stahlblauer Himmel, blaues Meer, offensichtlich ein typischer Ausschnitt aus einem Super-8-Film der Familie König. Heile Welt? Eine Bullerbü-Kindheit im abgeschiedenen kleinen Dorf Schallerup unweit der dänischen Grenze? So hatte ich es auf den ersten Seiten empfunden und lag weit daneben.
Clara, die uns ihre Geschichte erzählt, ist 1963 geboren, ein Sandwichkind, das sich mit zwei älteren Geschwistern und jüngeren Zwillingsbrüdern oft wie das sprichwörtliche fünfte Rad am Wagen fühlt. Der Vater, aus dem Ruhrgebiet stammend, ist Hausarzt mit eigener Dorfpraxis, ein Partylöwe, Anekdotenerzähler, charmanter und geistreicher Gastgeber, der als Student bezeichnenderweise den Spitznamen „Pirsch“ trug. Clara hängt besonders an ihm, vielleicht, weil die Mutter mehr mit den kaum zehn Monate jüngeren Zwillingen beschäftigt war. Sie ist seine „Königstochter“ und darf ihn schon als kleines Mädchen bei Hausbesuchen begleiten. Instinktiv spürt sie schon als Sechsjährige seine hinter einer Maske verborgene tiefe Traurigkeit. Auch die Mutter ist nicht glücklich in ihrer Ehe. Der Traum von einer Schauspielausbildung scheiterte an ihrem Vater, das Sportstudium hat sie früh zugunsten der Familie aufgegeben und nun führt sie das zeittypische Leben einer gutsituierten Arztgattin mit Villa, Auto, Ansehen, schönen Kleidern und regelmäßigen Friseurbesuchen. Sie ist eine „Meisterin im Drüber-hinweg-Gehen“, hält immer die Fassade aufrecht und schweigt, auch wenn sie wütend ist. Sie bleibt auch als Romanfigur im Schatten ihres Mannes und scheint machtlos angesichts der Familientragödie.
Claras Bericht über eine Kindheit und Jugend in den 1970er-Jahren dürfte in allererster Linie die begeistern, die diese Zeit erlebt haben. Die Mondlandung, der Unfalltod Alexandras, die dramatischen Ereignisse während der Olympiade in München, erste Diskobesuche, Schlager und Tritop – als nahezu Gleichaltrige wurden viele Erinnerungen bei mir wach. Sehr gut gefallen hat mir, wie Clara ihre Beobachtungen innerhalb der Familie beschreibt, wie sie für manches erst mit zunehmendem Alter Worte findet, die Geschwister instinktiv spüren, worüber nach außen Schweigepflicht gilt, und die Fassade trotz kollektiver Bemühungen schließlich nicht mehr aufrecht zu halten ist. Diese Teile des Buches sind ausgezeichnet gelungen, besser als Claras ausführliche pubertäre Auslassungen, die mich weniger interessiert haben. Die Sprache des Romans ist eher einfach, manchmal habe ich Übergänge zwischen Absätzen vermisst und der Text wirkte etwas aneinandergereiht, aber schließlich erzählt eine zu Beginn Sechs-, am Ende Fünfzehnjährige.
Sommer in Super 8 ist trotz leichter Lesbarkeit kein leichter Roman. Die Lektüre lohnt sich, vor allem – aber nicht nur – für die Generation 50 plus.
Anne Müller: Sommer in Super 8. Penguin 2018
www.randomhouse.de

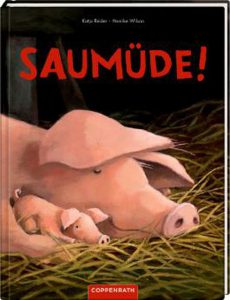
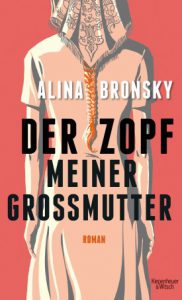
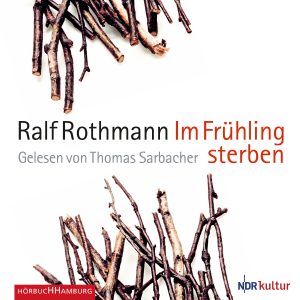
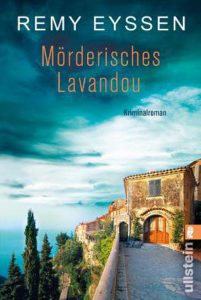
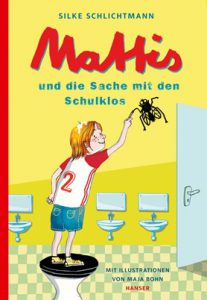 Mattis Hansen ist wahrlich nicht zu beneiden. Kaum setzt er eine seiner genialen Ideen in die Tat um, missversteht ihn sein gleichermaßen fantasie- wie humorloser Klassenlehrer und schreibt einen Beschwerdebrief an die Eltern. Anstatt sich die Geschichte aus Mattis‘ Sicht anzuhören, sammelt die Mutter die „Lügenbriefe“ lieber in einem schwarzen Aktenordner und prophezeit ihrem achtjährigen Sohn eine Karriere als Schwerverbrecher. Doch zum Glück ist Mattis schon in der 3c und kann die Wahrheit zu den Briefen, die seine Mutter partout nicht hören will, aufschreiben: „Damit Mama sie lesen kann. Und nicht mehr an den Schwerverbrecher glaubt. Sondern wieder an mich.“
Mattis Hansen ist wahrlich nicht zu beneiden. Kaum setzt er eine seiner genialen Ideen in die Tat um, missversteht ihn sein gleichermaßen fantasie- wie humorloser Klassenlehrer und schreibt einen Beschwerdebrief an die Eltern. Anstatt sich die Geschichte aus Mattis‘ Sicht anzuhören, sammelt die Mutter die „Lügenbriefe“ lieber in einem schwarzen Aktenordner und prophezeit ihrem achtjährigen Sohn eine Karriere als Schwerverbrecher. Doch zum Glück ist Mattis schon in der 3c und kann die Wahrheit zu den Briefen, die seine Mutter partout nicht hören will, aufschreiben: „Damit Mama sie lesen kann. Und nicht mehr an den Schwerverbrecher glaubt. Sondern wieder an mich.“