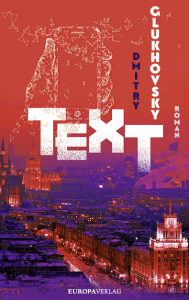![]() Man erfasst einen Menschen nie ganz
Man erfasst einen Menschen nie ganz
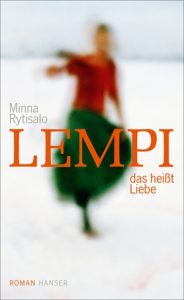
Wer war Lempi und was ist mit ihr geschehen? Zu Beginn erscheint sie verschwommen wie die Frau auf dem unscharfen Cover, das hervorragend zu diesem Roman passt. Drei Personen erzählen in der Du-Perspektive und im Präsens über sie: ihr Mann Viljami, mit dem sie ein halbes Jahr bis zu seiner Einberufung zusammengelebt hat, ihre Magd Elli und ihre Zwillingsschwester Sisko. Mit jeder Stimme wird das Bild schärfer – und doch hat Sisko sicher recht: „Man erfasst einen Menschen nie ganz.“
Das ausgezeichnete Nachwort der Übersetzerin Elina Kritzokat hilft bei der historischen Einordnung des Romans, denn über das Schicksal Lapplands im Zweiten Weltkrieg wusste ich leider wenig. Um sich nach dem Winterkrieg gegen Russland 1939 und dem Verlust von Teilen Ostkareliens vor weiteren russischen Angriffen zu schützen, ging Finnland von 1941 bis 1944 eine Waffenbruderschaft mit dem nationalsozialistischen Deutschen Reich ein. Finnen und Deutsche lebten und kämpften gemeinsam, bevor sie 1944 zu Feinden wurden. Finninnen, die sich mit Wehrmachtssoldaten eingelassen hatten, waren nun plötzlich Huren und Landesverräterinnen, ihre Kinder Bälger.
Während Sisko sich in einen Deutschen verliebt und von einer Zukunft in Hamburg träumt, will Lempi lieber einen Mann, der am Leben ist und Finnisch spricht. Sie, die temperamentvolle, mutige Kaufmannstochter mit Abitur, heiratet mehr oder weniger zufällig den jungen Bauern Viljami und zieht nach Pusuoja am See Korvasjärvi. Der traut seinem Glück kaum, stellt die Magd Elli ein und verbringt einige traumhafte Monate mit Lempi auf seinem Hof. Als er seine Einberufung erhält, bleibt die schwangere Lempi mit der Magd auf dem Hof zurück. Er sieht seine Frau nie wieder, denn als er äußerlich unversehrt, aber durch die Nachricht von Lempis Verschwinden als gebrochener Mann zurückkehrt, findet er nur seinen Sohn Aarre, Lempis Pflegekind Antero und die Magd Elli vor.
Die drei Erzählstimmen des Romans liefern ganz unterschiedliche Sichtweisen auf das Geschehen. Viljami berichtet in anrührender Weise über sein unfassbares Glück und die anschließende tiefe Verzweiflung und Trauer, Ellis legt ein Zeugnis des Hasses und der Eifersucht ab und präsentiert eine ganz andere Lempi, eine „nichtsnutzige Stadtgöre“, verwöhnte, faule, wichtigtuerische „Samtsaumschlampe“, und Sisko, die elf Minuten jüngere Schwester, erzählt als alte Frau im Rückblick von der gemeinsamen Jugend und der innigen Verbundenheit, aber auch Rivalitäten, bis sie sich beide für so ganz unterschiedliche Männer entschieden. Ihr Bericht umfasst den größten Zeitraum und ist zugleich ein berührendes Dokument über das Schicksal der finnischen Wehrmachtsbräute.
Lempi, das heißt Liebe ist ein vielschichtiger Roman mit immer neuen überraschenden Wendungen, raffiniert aufgebaut und großartig erzählt. Es lohnt sich, nach dem Ende einige Stellen nochmals zu lesen, denn ich habe manches Detail erst beim zweiten Mal voll und ganz verstanden. Je mehr ich über Lempi erfuhr, deren Name im Altfinnischen „Liebe“ bedeutet, desto faszinierter war ich von diesem Debütroman der 1974 geborenen finnischen Bloggerin und Autorin Minna Rytisalo, die dafür zu Recht in ihrer Heimat mit Preisen bedacht wurde. Die Verflechtung individueller Schicksale vor dem Hintergrund der finnischen Geschichte ist großartig gelungen und eindeutig eines meiner Lesehighlights 2018.
Minna Rytisalo: Lempi, das heißt Liebe. Carl Hanser 2018
www.hanser-literaturverlage.de

 Zum ersten Mal habe ich mich bei einem Städte-Kurztrip für einen Reiseführer aus dem Verlag Lehmstedt entschieden und war damit sehr zufrieden. Die Unterkunft für zwei Nächte war vorgebucht, Shopping nicht geplant und Restaurants suchen wir uns sowieso lieber spontan vor Ort, sodass „Lübeck an einem Tag – Ein Stadtrundgang“ genau das versprach, was ich gesucht hatte: die 31 wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Mit 47 Seiten ist der kleine Stadtführer handlich und leicht, trotzdem sind alle beschriebenen Punkte farbig bebildert und für die Kürze der Zeit ausführlich genug beschrieben. Zusätzlich finden sich an den Seiten farblich abgesetzte kleine Texte zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel „Travemünde“, „Hanse“, „Salz“, „Niederegger“, „Willy Brandt“, „Günter Grass“ oder „Thomas Mann“. Die angegebenen Öffnungs- und Führungszeiten waren, soweit ich es überprüfen konnte, korrekt, Eintrittspreise werden allerdings nicht genannt. In der vorderen Klappe findet man eine tabellarische Kurzübersicht über Lübecks Geschichte, in der hinteren einen Stadtplan der Innenstadt mit dem eingezeichneten Rundgang und den 31 beschriebenen Sehenswürdigkeiten. Da es kein Inhaltsverzeichnis gibt, dient diese Auflistung ersatzweise zum schnellen Einstieg, was ich leider erst nach einer Weile verstanden habe.
Zum ersten Mal habe ich mich bei einem Städte-Kurztrip für einen Reiseführer aus dem Verlag Lehmstedt entschieden und war damit sehr zufrieden. Die Unterkunft für zwei Nächte war vorgebucht, Shopping nicht geplant und Restaurants suchen wir uns sowieso lieber spontan vor Ort, sodass „Lübeck an einem Tag – Ein Stadtrundgang“ genau das versprach, was ich gesucht hatte: die 31 wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Mit 47 Seiten ist der kleine Stadtführer handlich und leicht, trotzdem sind alle beschriebenen Punkte farbig bebildert und für die Kürze der Zeit ausführlich genug beschrieben. Zusätzlich finden sich an den Seiten farblich abgesetzte kleine Texte zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel „Travemünde“, „Hanse“, „Salz“, „Niederegger“, „Willy Brandt“, „Günter Grass“ oder „Thomas Mann“. Die angegebenen Öffnungs- und Führungszeiten waren, soweit ich es überprüfen konnte, korrekt, Eintrittspreise werden allerdings nicht genannt. In der vorderen Klappe findet man eine tabellarische Kurzübersicht über Lübecks Geschichte, in der hinteren einen Stadtplan der Innenstadt mit dem eingezeichneten Rundgang und den 31 beschriebenen Sehenswürdigkeiten. Da es kein Inhaltsverzeichnis gibt, dient diese Auflistung ersatzweise zum schnellen Einstieg, was ich leider erst nach einer Weile verstanden habe.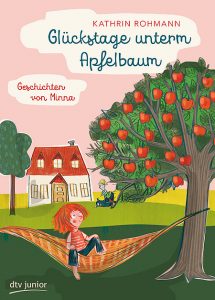
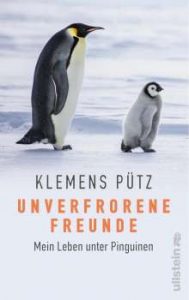
 Erfüllte Tage, viele interessante Gespräche und Veranstaltungen und jede Menge neue Eindrücke liegen nach drei Messetagen hinter mir. Auch wenn es am Ende nicht zum Buchblog-Award 2018 in der Kategorie „Allesleser“ gereicht hat: Es war ein großartiges Erlebnis, dabei zu sein. Ich danke den Ausrichtern für eine schöne Veranstaltung am Buchmesse-Freitag im neuen Frankfurt Pavilion und allen, die für mich gestimmt habe. Glückwunsch an die Gewinner!
Erfüllte Tage, viele interessante Gespräche und Veranstaltungen und jede Menge neue Eindrücke liegen nach drei Messetagen hinter mir. Auch wenn es am Ende nicht zum Buchblog-Award 2018 in der Kategorie „Allesleser“ gereicht hat: Es war ein großartiges Erlebnis, dabei zu sein. Ich danke den Ausrichtern für eine schöne Veranstaltung am Buchmesse-Freitag im neuen Frankfurt Pavilion und allen, die für mich gestimmt habe. Glückwunsch an die Gewinner!
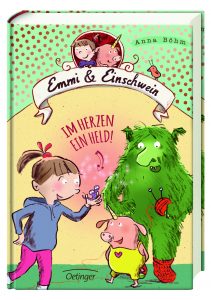
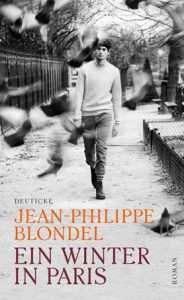
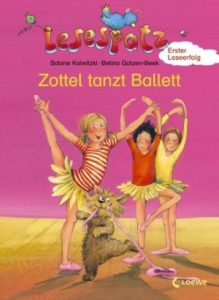 Nina liebt ihren kleinen Hund Zottel, auch wenn der immer mal Quatsch macht. Zottel ist klug, zerfetzt Papas Zeitung, verbuddelt Mamas Schal im Blumenbeet, singt zu Ninas Flötenspiel, übt mit ihr tanzen – nur zur Ballettaufführung darf er leider nicht mit. Aber Zottel wäre nicht Zottel, wenn er nicht einen Weg in den Ballettsaal fände, und so bekommt er am Ende einer fröhlich-ungewöhnlichen Aufführung sogar Extra-Applaus.
Nina liebt ihren kleinen Hund Zottel, auch wenn der immer mal Quatsch macht. Zottel ist klug, zerfetzt Papas Zeitung, verbuddelt Mamas Schal im Blumenbeet, singt zu Ninas Flötenspiel, übt mit ihr tanzen – nur zur Ballettaufführung darf er leider nicht mit. Aber Zottel wäre nicht Zottel, wenn er nicht einen Weg in den Ballettsaal fände, und so bekommt er am Ende einer fröhlich-ungewöhnlichen Aufführung sogar Extra-Applaus.