![]() Unverhofftes Wiedersehen
Unverhofftes Wiedersehen
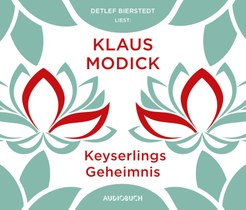 Eduard von Keyserling (1855-1918), baltischer Graf, Dandy und Dichter, ist heute als deutscher Schriftsteller des Impressionismus eher ein Geheimtipp. Sein Porträt, gemalt von Lovis Corinth, das in der Münchner Neuen Pinakothek hängt, dürfte dagegen vielen bekannt sein. Keyserling war, als Corinth ihn bei einer gemeinsamen Sommerfrische am Starnberger See im Sommer 1901 malte, 46 Jahre alt und von der Syphilis bereits schwer gezeichnet, doch in den Augen des Malers durch das Geheimnis um seine Vergangenheit interessant. Was Corinth dem Grafen nicht entlocken konnte, enthüllt Klaus Modick in seiner teils fiktiven Künstlerbiografie Keyserlings Geheimnis: den Dorpater Skandal, den Wendepunkt in Keyserlings Leben.
Eduard von Keyserling (1855-1918), baltischer Graf, Dandy und Dichter, ist heute als deutscher Schriftsteller des Impressionismus eher ein Geheimtipp. Sein Porträt, gemalt von Lovis Corinth, das in der Münchner Neuen Pinakothek hängt, dürfte dagegen vielen bekannt sein. Keyserling war, als Corinth ihn bei einer gemeinsamen Sommerfrische am Starnberger See im Sommer 1901 malte, 46 Jahre alt und von der Syphilis bereits schwer gezeichnet, doch in den Augen des Malers durch das Geheimnis um seine Vergangenheit interessant. Was Corinth dem Grafen nicht entlocken konnte, enthüllt Klaus Modick in seiner teils fiktiven Künstlerbiografie Keyserlings Geheimnis: den Dorpater Skandal, den Wendepunkt in Keyserlings Leben.
Sicher ist, dass Keyserling seinen Studienort Dorpat 1877 fluchtartig verlassen musste, sein Studium der Rechtswissenschaften unbeendet ließ und in der baltischen Heimat zum gesellschaftlichen Außenseiter erklärt wurde. Nun, 23 Jahre später und nach einer schicksalhaften Begegnung bei einem Konzertbesuch, denkt er an die Dorpater Zeit zurück, an den Skandal, an die anschließenden Studienjahre in Wien, in denen er sich der Philosophie, der Kunstgeschichte und den Frauen widmete. Er lässt die Jahre 1890 bis 1894 revuepassieren, als er ohne jeden Hang und ohne Begabung zur Landwirtschaft und Gutsverwaltung in Vertretung seines älteren Bruders die Geschicke auf Schloss Paddern leiten musste, und denkt an sein Leben in der Schwabinger Bohème, das er nun endlich führen kann, ein Dasein im Müßiggang und ohne das Korsett seines Standes.
Das Besondere an Klaus Modicks Roman ist für mich nicht, dass er den Dorpater Skandal mit Leben füllt, obwohl er dies sehr geschickt und glaubhaft erzählt. Die Besonderheit liegt vielmehr darin, wie atmosphärisch er über die verschiedenen Stationen in Keyserlings Leben berichtet: vom Studentendasein in Dorpat mit den Studentenverbindungen und starren Konventionen, vom Leben auf Schloss Paddern und dem im Niedergang begriffenen baltischen Landadel, von den schon deutlich unkonventionelleren Jahren in Wien kurz vor der Jahrhundertwende und vom Schwabinger Künstlerleben mit den Freunden Max Halbe, Lovis Corinth und dem schwierigen Frank Wedekind. Jede Zeit hat ihre eigene Stimmung und der Spannungsbogen bleibt dank des Dorpater Geheimnisses bis zum Schluss erhalten. Lediglich ein paar Jahreszahlen mehr hätte ich mir zur Orientierung gewünscht.
Der Sprecher Detlef Bierstedt liest den glücklicherweise ungekürzten Roman auf sechs CDs in 400 Minuten mit seiner sehr angenehmen Stimme, die manchem als Synchronstimme von George Clooney bekannt sein dürfte. Er interpretiert den Text angemessen langsam und unaufgeregt und bringt sowohl die Melancholie als auch die feine Ironie hervorragend zur Geltung. Ohne die Stimme allzu sehr zu verstellen, gibt er jedem der Protagonisten eine eigene Note, dem sinnierenden Keyserling genauso wie dem exzentrischen Wedekind, dem polternden Max Halbe oder dem neugierigen Corinth. Gut gefallen haben mir auch die wenigen Sätze in baltischer Mundart, obwohl ich deren Qualität nicht fachmännisch beurteilen kann.
Sollte es Klaus Modicks Absicht gewesen sein, zur Lektüre von Keyserlings Werken anzuregen, so war er damit zumindest bei mir erfolgreich: Wellen (1911) liegt zur baldigen Lektüre bereit.
Klaus Modick: Keyserlings Geheimnis. Sprecher: Detlef Bierstedt. Audiobuch 2018
www.audiobuch.com

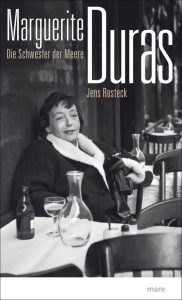 Es ist mehr als 25 Jahre her, dass ich Der Liebhaber und Hiroshima mon amour gelesen habe. Sie sind mir jedoch so nachhaltig im Gedächtnis geblieben, dass mich die neu erschienene Biografie Marguerite Duras – Die Schwester der Meere des promovierten Musikologen und Literaturwissenschaftlers Jens Rosteck sofort interessiert hat.
Es ist mehr als 25 Jahre her, dass ich Der Liebhaber und Hiroshima mon amour gelesen habe. Sie sind mir jedoch so nachhaltig im Gedächtnis geblieben, dass mich die neu erschienene Biografie Marguerite Duras – Die Schwester der Meere des promovierten Musikologen und Literaturwissenschaftlers Jens Rosteck sofort interessiert hat.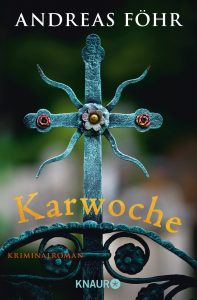 Der Einstieg in diesen dritten Tegernsee-Krimi von Andreas Föhr nach dem erschreckenden Prolog ist wahrlich rasant: Am Gründonnerstag 2010 fährt Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner mit 150 Stundenkilometer ein Autorennen gegen den LKW seines Kumpels vom Achensee zum Tegernsee. Pech nur, dass er dabei fast mit seinem entgegenkommenden Kollegen Kriminalhauptkommissar Clemens Wallner und dessen Freundin Vera auf dem Weg in den Urlaub kollidiert wäre. Um abzulenken, inszeniert Kreuthner eine Fahrzeugkontrolle und entdeckt im LKW des Freundes eine Leiche, die Ex-Schauspielerin und nach einem Unfall vor zwölf Jahre schwer entstellte Hanna Lohwerk. Bei einer Hausdurchsuchung des Opfers findet die eilends gegründete SoKo Fotos eines anderen Verbrechens: Am 25.12.2009 kam auf dem Anwesen des Schauspielerehepaars Katharina und Dieter Millruth über dem Schliersee die 20-jährige Tochter Leni durch einen Schrotschuss zu Tode. Der Täter wurde dank eines Geständnisses schnell ermittelt, das Gericht verurteilte ihn zu 18 Monaten auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung. Doch mit den Fotos stellt sich das Geschehen plötzlich in neuem Licht dar und die zeitlichen Angaben der Familie Millruth sind nicht mehr zu halten. Wer hat damals wirklich geschossen und warum?
Der Einstieg in diesen dritten Tegernsee-Krimi von Andreas Föhr nach dem erschreckenden Prolog ist wahrlich rasant: Am Gründonnerstag 2010 fährt Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner mit 150 Stundenkilometer ein Autorennen gegen den LKW seines Kumpels vom Achensee zum Tegernsee. Pech nur, dass er dabei fast mit seinem entgegenkommenden Kollegen Kriminalhauptkommissar Clemens Wallner und dessen Freundin Vera auf dem Weg in den Urlaub kollidiert wäre. Um abzulenken, inszeniert Kreuthner eine Fahrzeugkontrolle und entdeckt im LKW des Freundes eine Leiche, die Ex-Schauspielerin und nach einem Unfall vor zwölf Jahre schwer entstellte Hanna Lohwerk. Bei einer Hausdurchsuchung des Opfers findet die eilends gegründete SoKo Fotos eines anderen Verbrechens: Am 25.12.2009 kam auf dem Anwesen des Schauspielerehepaars Katharina und Dieter Millruth über dem Schliersee die 20-jährige Tochter Leni durch einen Schrotschuss zu Tode. Der Täter wurde dank eines Geständnisses schnell ermittelt, das Gericht verurteilte ihn zu 18 Monaten auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung. Doch mit den Fotos stellt sich das Geschehen plötzlich in neuem Licht dar und die zeitlichen Angaben der Familie Millruth sind nicht mehr zu halten. Wer hat damals wirklich geschossen und warum?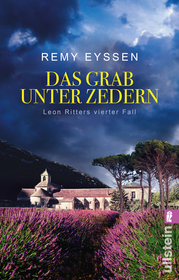 Nach Tödlicher Lavendel, Schwarzer Lavendel und Gefährlicher Lavendel war ich sehr gespannt, welches Adjektiv die im Mittelmeerraum beheimatete Pflanze im vierten Band der provenzalischen Krimireihe von Remy Eyssen schmücken würde, doch mit Das Grab unter Zedern rückt dieses Mal eine andere botanische Gattung in den Fokus. Das bekannte Personal bleibt allerdings glücklicherweise erhalten, in erster Linie der deutsche Gerichtsmediziner Dr. Leon Ritter vom Krankenhaus Saint Sulpice und seine Lebenspartnerin Capitaine Isabelle Morell, stellvertretende Polizeichefin der Gendarmerie nationale von Le Lavandou. Das Duo ist nicht nur privat inzwischen ein gutes Paar, auch ihre berufliche Verbindung ist überaus erfolgreich. Die Polizistin hat die „spezielle Arbeitsweise“ Leons schätzen gelernt hat und vertraut im Gegensatz zu ihren Kollegen seinem Bauchgefühl und seinen Methoden. Umso betroffener reagieren Leon und Isabelle, als der Klinikchef ihm einen zweiten Gerichtsmediziner aus Avignon zur Disziplinierung wegen der ungewöhnlichen Vorgehensweisen zur Seite stellt. Ein Schock für den Einzelkämpfer Leon, dem Intrigen, Mobbing und Eifersüchteleien zuwider sind.
Nach Tödlicher Lavendel, Schwarzer Lavendel und Gefährlicher Lavendel war ich sehr gespannt, welches Adjektiv die im Mittelmeerraum beheimatete Pflanze im vierten Band der provenzalischen Krimireihe von Remy Eyssen schmücken würde, doch mit Das Grab unter Zedern rückt dieses Mal eine andere botanische Gattung in den Fokus. Das bekannte Personal bleibt allerdings glücklicherweise erhalten, in erster Linie der deutsche Gerichtsmediziner Dr. Leon Ritter vom Krankenhaus Saint Sulpice und seine Lebenspartnerin Capitaine Isabelle Morell, stellvertretende Polizeichefin der Gendarmerie nationale von Le Lavandou. Das Duo ist nicht nur privat inzwischen ein gutes Paar, auch ihre berufliche Verbindung ist überaus erfolgreich. Die Polizistin hat die „spezielle Arbeitsweise“ Leons schätzen gelernt hat und vertraut im Gegensatz zu ihren Kollegen seinem Bauchgefühl und seinen Methoden. Umso betroffener reagieren Leon und Isabelle, als der Klinikchef ihm einen zweiten Gerichtsmediziner aus Avignon zur Disziplinierung wegen der ungewöhnlichen Vorgehensweisen zur Seite stellt. Ein Schock für den Einzelkämpfer Leon, dem Intrigen, Mobbing und Eifersüchteleien zuwider sind.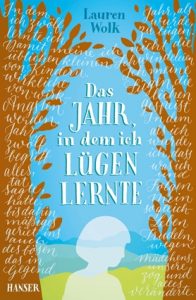 Bis Betty Glengarry im Oktober 1943 in ihre Klasse kommt, ist die Schule für die elfjährige Ich-Erzählerin Annabelle ein friedlicher Ort und die Welt in Ordnung. Betty gilt als schwer erziehbar, weshalb ihre überforderte Mutter sie zu ihren Großeltern aufs Land geschickt hat. Annabelle dagegen kennt nur das harmonische Farmleben mit ihrer Großfamilie, in dem das Böse bisher keinen Platz hatte. Betty hat keineswegs die Absicht, ihre Chance auf einen Neuanfang zu nutzen, und Annabelle wird ihr erstes Opfers. Was vergleichsweise harmlos mit Bleistiftpiksen unter der Bank beginnt, wird schnell zu Erpressung und Annabelle, die um ihre jüngeren Brüder fürchtet, sieht zunächst keine andere Möglichkeit, als erstmals zu lügen. Es kommt noch schlimmer: Annabelles beste Freundin Ruth wird von einem geworfenen Stein schwer verletzt und einer ihrer Brüder kommt durch einen gespannten Draht zu Schaden, alles durch Bettys Bösartigkeit, wie Annabelle vermutet. Doch Betty, die so lieb aussehen und sich der vollen Unterstützung ihrer Großeltern sicher sein kann, beschuldigt stattdessen den Außenseiter und Sonderling Toby, der aus dem Nichts gekommen ist, in einer alten Räucherhütte haust und stets drei Gewehre über der Schulter trägt. Die Menschen im Dorf glauben jedenfalls eher einem Mädchen, das wie ein Unschuldslamm wirkt, als einem Mann mit dem wilden Aussehen eines Bösewichts und unklarer Vergangenheit. Annabelle jedoch ist fest von Tobys Unschuld überzeugt und setzt alles daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Bis Betty Glengarry im Oktober 1943 in ihre Klasse kommt, ist die Schule für die elfjährige Ich-Erzählerin Annabelle ein friedlicher Ort und die Welt in Ordnung. Betty gilt als schwer erziehbar, weshalb ihre überforderte Mutter sie zu ihren Großeltern aufs Land geschickt hat. Annabelle dagegen kennt nur das harmonische Farmleben mit ihrer Großfamilie, in dem das Böse bisher keinen Platz hatte. Betty hat keineswegs die Absicht, ihre Chance auf einen Neuanfang zu nutzen, und Annabelle wird ihr erstes Opfers. Was vergleichsweise harmlos mit Bleistiftpiksen unter der Bank beginnt, wird schnell zu Erpressung und Annabelle, die um ihre jüngeren Brüder fürchtet, sieht zunächst keine andere Möglichkeit, als erstmals zu lügen. Es kommt noch schlimmer: Annabelles beste Freundin Ruth wird von einem geworfenen Stein schwer verletzt und einer ihrer Brüder kommt durch einen gespannten Draht zu Schaden, alles durch Bettys Bösartigkeit, wie Annabelle vermutet. Doch Betty, die so lieb aussehen und sich der vollen Unterstützung ihrer Großeltern sicher sein kann, beschuldigt stattdessen den Außenseiter und Sonderling Toby, der aus dem Nichts gekommen ist, in einer alten Räucherhütte haust und stets drei Gewehre über der Schulter trägt. Die Menschen im Dorf glauben jedenfalls eher einem Mädchen, das wie ein Unschuldslamm wirkt, als einem Mann mit dem wilden Aussehen eines Bösewichts und unklarer Vergangenheit. Annabelle jedoch ist fest von Tobys Unschuld überzeugt und setzt alles daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen.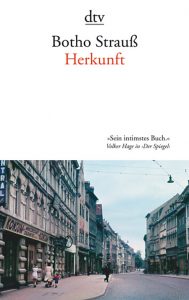 Kurz vor seinem 70. Geburtstag hat der deutsche Schriftsteller und Dramatiker Botho Strauß ein sehr privates Buch über seine Kindheit, vor allem aber über seinen Vater veröffentlicht. Es sind kleine Erinnerungsminiaturen, Gedankensplitter, die den Vater, für den er sich als Kind und Jugendlicher oft geschämt hat, weil er „anders“ war, rehabilitieren. Anlass für das Zusammentragen dieser Splitter waren der posthum begangene 100. Geburtstag des Vaters im Jahr 1990 und der Umzug der Mutter ins Altersheim 1996. Letzterer ging einher mit der Auflösung der seit 42 Jahren angemieteten Wohnung in Bad Ems, Römerstraße 18, dritter Stock, die am Ende der beiden Kapitel des knapp 100 Seiten umfassenden Büchleins thematisiert wird.
Kurz vor seinem 70. Geburtstag hat der deutsche Schriftsteller und Dramatiker Botho Strauß ein sehr privates Buch über seine Kindheit, vor allem aber über seinen Vater veröffentlicht. Es sind kleine Erinnerungsminiaturen, Gedankensplitter, die den Vater, für den er sich als Kind und Jugendlicher oft geschämt hat, weil er „anders“ war, rehabilitieren. Anlass für das Zusammentragen dieser Splitter waren der posthum begangene 100. Geburtstag des Vaters im Jahr 1990 und der Umzug der Mutter ins Altersheim 1996. Letzterer ging einher mit der Auflösung der seit 42 Jahren angemieteten Wohnung in Bad Ems, Römerstraße 18, dritter Stock, die am Ende der beiden Kapitel des knapp 100 Seiten umfassenden Büchleins thematisiert wird. Ab und zu lese oder höre ich mit Vergnügen Regionalkrimis und bei einigen Reihen bin ich inzwischen zur Wiederholungstäterin geworden, so zum Beispiel bei Jörg Maurers Allgäu-Krimis, bei Jean-Luc Bannalecs Ermittlungen in der Bretagne oder bei Remy Eyssens Provencemördern. Etwas Ähnliches hatte ich mir von der Algarve-Reihe von Gil Ribeiro, Pseudonym eines deutschen Autors, versprochen, allerdings nur zum Teil gefunden. Grund dafür ist, dass mir der Schwerpunkt bei Lost in Fuseta – Die Spur der Schatten zu sehr auf dem regionalen Hintergrund einerseits und den Besonderheiten des autistischen Kommissars andererseits liegt. Der gut angelegte, bis in Portugals interessante Kolonialzeit und ins Parlament reichende Fall kommt dagegen zur kurz. Von der exakten Aufzählung von Straßennamen und Speisen aller Art war ich zeitweise genervt und die Überbetonung verstärkte nicht wie erwartet meinen Wunsch nach einer Algarvereise. Auch die ständig wiederholten Schilderungen zu Kommissar Losts Asperger-Syndrom waren für mich zuviel des Guten, weniger wäre in beiden Fällen mehr gewesen. Ausgesprochen originell fand ich dagegen das von Lost benutzte, bedauerlicherweise fiktive „Kompendium sinnloser Sätze“, aus dem der völlig emotionslose Alemão zitiert – entlarvend und urkomisch zugleich. Gerne verzichtet hätte ich aber auf Losts ebenso unnötige wie unglaubwürdige Liebesverwicklungen.
Ab und zu lese oder höre ich mit Vergnügen Regionalkrimis und bei einigen Reihen bin ich inzwischen zur Wiederholungstäterin geworden, so zum Beispiel bei Jörg Maurers Allgäu-Krimis, bei Jean-Luc Bannalecs Ermittlungen in der Bretagne oder bei Remy Eyssens Provencemördern. Etwas Ähnliches hatte ich mir von der Algarve-Reihe von Gil Ribeiro, Pseudonym eines deutschen Autors, versprochen, allerdings nur zum Teil gefunden. Grund dafür ist, dass mir der Schwerpunkt bei Lost in Fuseta – Die Spur der Schatten zu sehr auf dem regionalen Hintergrund einerseits und den Besonderheiten des autistischen Kommissars andererseits liegt. Der gut angelegte, bis in Portugals interessante Kolonialzeit und ins Parlament reichende Fall kommt dagegen zur kurz. Von der exakten Aufzählung von Straßennamen und Speisen aller Art war ich zeitweise genervt und die Überbetonung verstärkte nicht wie erwartet meinen Wunsch nach einer Algarvereise. Auch die ständig wiederholten Schilderungen zu Kommissar Losts Asperger-Syndrom waren für mich zuviel des Guten, weniger wäre in beiden Fällen mehr gewesen. Ausgesprochen originell fand ich dagegen das von Lost benutzte, bedauerlicherweise fiktive „Kompendium sinnloser Sätze“, aus dem der völlig emotionslose Alemão zitiert – entlarvend und urkomisch zugleich. Gerne verzichtet hätte ich aber auf Losts ebenso unnötige wie unglaubwürdige Liebesverwicklungen.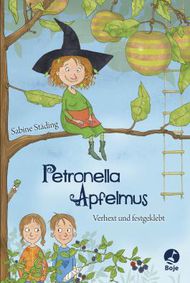 Seit sie den letzten Müller Gisbert Mühlstein erfolgreich vertrieben hat, lebt die Apfelbaumhexe Petronella Apfelmus zusammen mit ihrem Freund Lucius Hirschkäfer und den Apfelmännchen Gurkenhut, Spargelzahn, Rübenbach, Karottenwams und Bohnenhals friedlich im alten Mühlgarten. Kein Wunder also, dass sie gar nicht erfreut ist, als Familie Kuchenbrand mit den Zwillingen Luis und Lea in das Müllerhaus einzieht. Wäre doch gelacht, wenn eine Hexe wie sie die Eindringlinge nicht vertreiben könnte! Doch als Luis und Lea eines Tages über die magische Strickleiter zu ihr ins Apfelhaus kommen, geht der kleinen Hexe das Herz auf, denn die beiden Kinder sind eigentlich gar nicht so übel! Statt Gummispinnen und Unwetter gibt es nun leckeren Apfelkuchen für die „neugierigen Frettchen“ und dazu ein Rezept für den Kuchenbackwettbewerb, bei dem Lea und Luis unbedingt gewinnen wollen. Doch auch Herr Kümmerling, der unsympathische Ex-Chef ihres Vaters in der Bäckerei, möchte unbedingt siegen und schreckt vor nichts zurück. Ein Glück, dass die Kinder ihre neue magische Freundin haben! So wird am Ende doch noch alles gut für Lea und Luis, die ursprünglich keinesfalls ins Müllerhaus einziehen wollten, für Papa Paul, der eine neue Arbeit findet, und für Petronella, der der Trubel wider Erwarten gut gefällt…
Seit sie den letzten Müller Gisbert Mühlstein erfolgreich vertrieben hat, lebt die Apfelbaumhexe Petronella Apfelmus zusammen mit ihrem Freund Lucius Hirschkäfer und den Apfelmännchen Gurkenhut, Spargelzahn, Rübenbach, Karottenwams und Bohnenhals friedlich im alten Mühlgarten. Kein Wunder also, dass sie gar nicht erfreut ist, als Familie Kuchenbrand mit den Zwillingen Luis und Lea in das Müllerhaus einzieht. Wäre doch gelacht, wenn eine Hexe wie sie die Eindringlinge nicht vertreiben könnte! Doch als Luis und Lea eines Tages über die magische Strickleiter zu ihr ins Apfelhaus kommen, geht der kleinen Hexe das Herz auf, denn die beiden Kinder sind eigentlich gar nicht so übel! Statt Gummispinnen und Unwetter gibt es nun leckeren Apfelkuchen für die „neugierigen Frettchen“ und dazu ein Rezept für den Kuchenbackwettbewerb, bei dem Lea und Luis unbedingt gewinnen wollen. Doch auch Herr Kümmerling, der unsympathische Ex-Chef ihres Vaters in der Bäckerei, möchte unbedingt siegen und schreckt vor nichts zurück. Ein Glück, dass die Kinder ihre neue magische Freundin haben! So wird am Ende doch noch alles gut für Lea und Luis, die ursprünglich keinesfalls ins Müllerhaus einziehen wollten, für Papa Paul, der eine neue Arbeit findet, und für Petronella, der der Trubel wider Erwarten gut gefällt…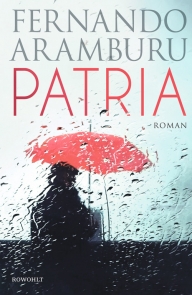 756 Seiten Text, fünf Seiten baskisches Glossar, 126 Kapitel, neun Protagonisten, ein Thema, das sind die nüchternen Fakten zu Fernando Aramburus schwergewichtigem Roman Patria. Der Autor, der seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebt, hat über das beherrschende Thema seiner baskischen Heimat seit der Gründung der ETA im Jahr 1959 geschrieben: den Terror. Obwohl die Organisation 2011 die Waffen offiziell niedergelegt und den Kampf für einen linksnationalistischen, unabhängigen Staat nach über 4000 Anschlägen und mehr als 800 Toten beendet hat, sind die Auswirkungen bis heute deutlich spürbar. Kein Wunder also, dass der Roman in Spanien mehrfach preisgekrönt wurde und reißenden Absatz findet.
756 Seiten Text, fünf Seiten baskisches Glossar, 126 Kapitel, neun Protagonisten, ein Thema, das sind die nüchternen Fakten zu Fernando Aramburus schwergewichtigem Roman Patria. Der Autor, der seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebt, hat über das beherrschende Thema seiner baskischen Heimat seit der Gründung der ETA im Jahr 1959 geschrieben: den Terror. Obwohl die Organisation 2011 die Waffen offiziell niedergelegt und den Kampf für einen linksnationalistischen, unabhängigen Staat nach über 4000 Anschlägen und mehr als 800 Toten beendet hat, sind die Auswirkungen bis heute deutlich spürbar. Kein Wunder also, dass der Roman in Spanien mehrfach preisgekrönt wurde und reißenden Absatz findet.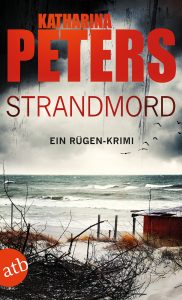 Strandmord ist der siebte Band der Rügenkrimi-Reihe von Katharina Peters und der fünfte, den ich gelesen habe. Das besondere an dieser Reihe: Alle Bände sind von gleichmäßig guter Qualität, die Handlungen spannend, die Ermittlerin Romy Beccare, Münchnerin mit italienischen Wurzeln und dem entsprechenden Temperament, sympathisch, die Sprache einfach, aber nicht platt. Für mich sind diese Krimis eine perfekte Bahnlektüre, auch mit der Gefahr, meine Haltestelle zu verpassen.
Strandmord ist der siebte Band der Rügenkrimi-Reihe von Katharina Peters und der fünfte, den ich gelesen habe. Das besondere an dieser Reihe: Alle Bände sind von gleichmäßig guter Qualität, die Handlungen spannend, die Ermittlerin Romy Beccare, Münchnerin mit italienischen Wurzeln und dem entsprechenden Temperament, sympathisch, die Sprache einfach, aber nicht platt. Für mich sind diese Krimis eine perfekte Bahnlektüre, auch mit der Gefahr, meine Haltestelle zu verpassen.