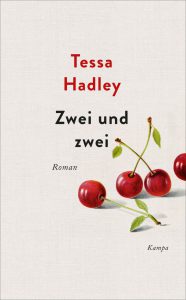Blitz und Donner – was für ein Kinderbuch!
Blitz und Donner – was für ein Kinderbuch!
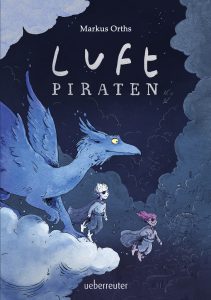
Wer bisher dachte, Luftlöcher wären einfach leerer Raum, der wird im Kinderbuch Luftpiraten von Max Orths eines Besseren belehrt. Nein, Luftlöcher sind die Behausungen finsterer Gesellen, der Luftpiraten:
„Im Gegensatz zu den Piraten auf dem Meer sind Luftpiraten hoch über den Wolken Einzelgänger. Raue Gesellen sind das, die ständig schlechte Laune haben, verbittert und griesgrämig. Und weil sie so griesgrämig sind, ist die Haut der Luftpiraten grieselgrau. Weite, lange Umhänge verbergen den mächtigen Brustkorb. So einen Brustkorb braucht ein Luftpirat, um tief Luft zu holen vor dem Brüllen. Denn ein Luftpirat brüllt oft und laut.“
Im Anderssein lautert Gefahr
Einer dieser unerfreulichen Gesellen ist Doktor Amadäus Adiaba, Luftpiratenlehrer am Johann-Sebastian-Krach-Gymnasium in der Luftstadt Ätheria, bei dem die Luftpiratenkindern in ihrem zweiten Lebensjahr das Blitzen, Streiten, Brüllen, Hässlich-Lachen und viele andere nützliche Schlüsselqualifikation lernen. Eigentlich ist er damit von der Aufzucht eigener Kinder befreit, trotzdem erhält er eines Tages ein Luftpiratenbaby im Paket zugestellt, der üblichen Zuteilungsweise des Luftpiratennachwuchses. Dem ersten Schock folgt ein zweiter: Sein Luftpiratenkind ist nicht aschgrau, wie es sich gehört hätte, sondern schneeweiß, das rechte Auge kann nicht blitzen und es schreit nicht, sondern strahlt ihn freundlich an. Der griesgrämige, verbitterte Eigenbrötler Adiaba kann es kaum fassen, aber in Windeseile erobert das Kind sein Herz. Dabei müsste er den Weißen Luftpiraten, die „Missgeburt“, eigentlich laut Luftpiratengesetzbuch sofort ertränken, anderenfalls droht ihm lebenslange Haft im Tafelberg. Stattdessen tauft er das fröhliche Kind auf den Namen Zwolle, kauft ihm zur Gesellschaft einen Luftikus und versteckt ihn vor der Gemeinschaft. Dumm nur, dass Zwolle an seinem ersten Geburtstag unbedingt wie alle anderen Luftpiratenkinder in die Schule möchte und sich nicht davon abbringen lässt. Nun wird es trotz Verkleidung und List brandgefährlich für Vater und Sohn. Ein Glück, dass Zwolle mit seinem verwandlungsfreudigen Luftikus, seiner überaus temperamentvollen Mitschülerin Franka, dem klugen Professor Theodor Rättich und dem Hauch-und-Geist-Wesen Charley Gottchen Unterstützung gegen den Alleinherrscher Peer Dekret, dessen Spiegelglatte und den gefährlichen Kugelblitz Zephyr hat…
Ein Kinderbuch mit Klassiker-Potential
Luftpiraten ist nicht nur ein höchst spannendes Abenteuerbuch für Kinder ab acht Jahren, zum Vorlesen auch schon ab sechs, es ist ein Roman, in dem mit überbordender Fantasie eine komplexe Welt erschaffen wird. Die altersgerechten, manchmal comichaft anmutenden Illustrationen und kleinen Verzierungen in Schwarz-Weiß-Blau-Tönen von Lena Winkel sind genauso spielerisch leicht wie der Text. Besonders gut gelungen ist das Layout des gefährlichsten Kapitels Nummer 23 auf schwarzem Untergrund. Die genialen Wortspiele, vor allem rund um die Themen Luft und Wetter, machen Kindern wie Erwachsenen großen Spaß; Erklärungen wie die für die Milchstraße (die überschüssige Milch aus den Wolken, die in den Wolkereien nicht zu Wolkereiprodukten verarbeitet werden kann) oder für Platzregen (ein Luftpirat platzt vor Wut und seine 90% Wasseranteil platschen auf die Erde) sind von bestrickender Logik. Nichts wirkt in dieser Geschichte gekünstelt oder hohl, die Sprachbilder und Wortspiele sitzen und der große Spaß, den Markus Orths beim Ausdenken und Schreiben sicher hatte, überträgt sich nahtlos auf die (Vor-)Lesenden.
Markus Orths: Luftpiraten. Mit Illustrationen von Lena Winkel. Ueberreuter 2020
www.ueberreuter.de

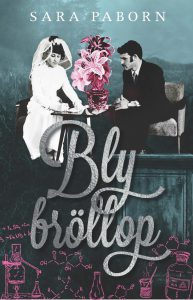
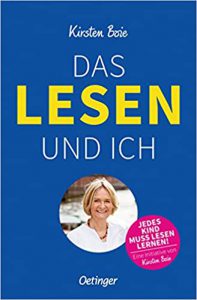
 Anlässlich ihres 70. Geburtstages am 19. März 2020 veröffentlichte der Oetinger Verlag Kirsten Boies Streitschrift zum Thema Lesen. Für ihr großes Engagement wurde die ehemalige Lehrerin im Juni 2019 auf den Buchtagen in Berlin hochverdient mit der Plakette „Förderin des Buches“ geehrt. Aufgeschreckt durch Studien, nach denen fast ein Fünftel der deutschen Zehnjährigen nicht sinnentnehmend lesen kann, aber auch durch eigene Erfahrungen bei Lesungen in Grundschulen, startete Kirsten Boie im Sommer 2018 mit vielen prominenten Erstunterzeichnern die „Hamburger Erklärung“ mit Forderungen an die Politik zur Förderung der Lesekompetenz.
Anlässlich ihres 70. Geburtstages am 19. März 2020 veröffentlichte der Oetinger Verlag Kirsten Boies Streitschrift zum Thema Lesen. Für ihr großes Engagement wurde die ehemalige Lehrerin im Juni 2019 auf den Buchtagen in Berlin hochverdient mit der Plakette „Förderin des Buches“ geehrt. Aufgeschreckt durch Studien, nach denen fast ein Fünftel der deutschen Zehnjährigen nicht sinnentnehmend lesen kann, aber auch durch eigene Erfahrungen bei Lesungen in Grundschulen, startete Kirsten Boie im Sommer 2018 mit vielen prominenten Erstunterzeichnern die „Hamburger Erklärung“ mit Forderungen an die Politik zur Förderung der Lesekompetenz.
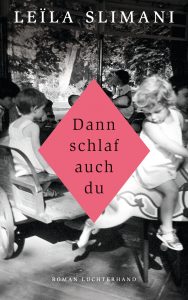
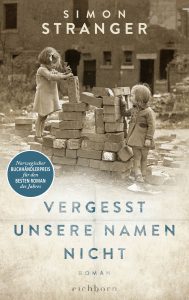
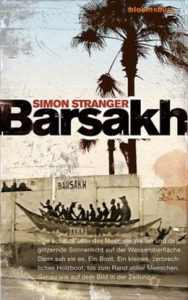

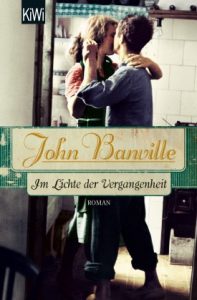
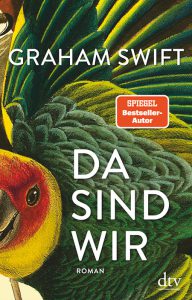
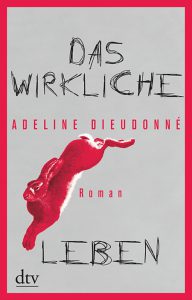
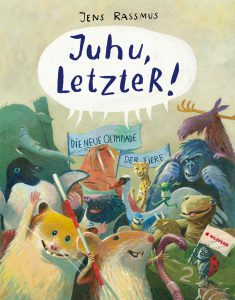
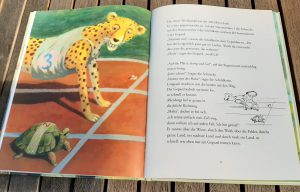
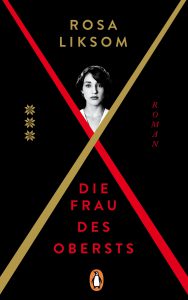
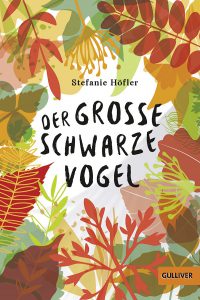
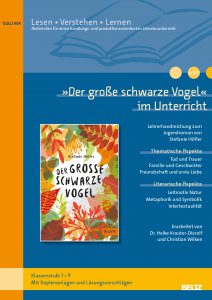 sondern auch für Erwachsene eine höchst empfehlenswerte Lektüre ist.
sondern auch für Erwachsene eine höchst empfehlenswerte Lektüre ist.