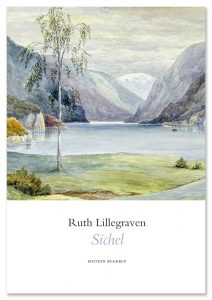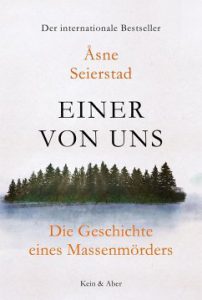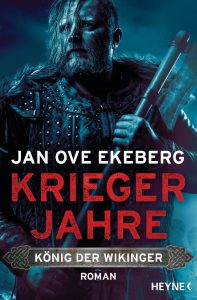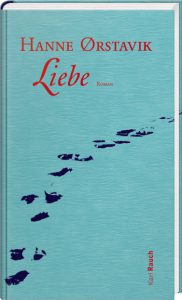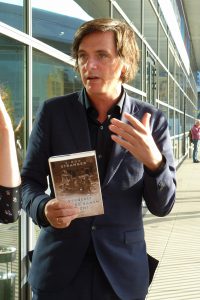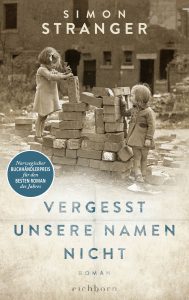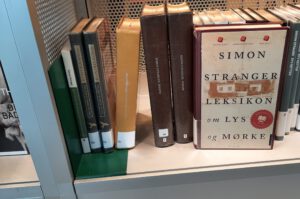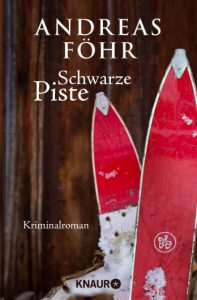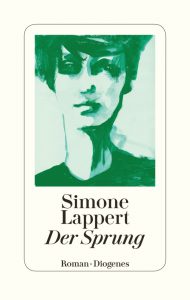Vergangenheitsfahrerin wider Willen
Vergangenheitsfahrerin wider Willen
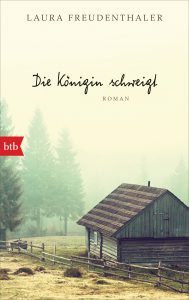
Fanny ist alt, einsam und fühlt die Müdigkeit aus all den vielen Jahren ihres Lebens. Sie lebt alleine in einer Kleinstadt in dem Häuschen, das sie nach dem Tod ihres Mannes einst für sich und ihren Sohn gebaut hat. Nur zwei Menschen besuchen sie noch: Hanna, ihre ehemalige Ziehtochter auf Zeit, und ihre Enkelin. Der Wunsch der beiden jüngeren Frauen, Fanny möge sich zurückerinnern, bleibt allerdings unerfüllt, das Notizbuch, das die Enkelin ihr schenkt, leer, denn Fanny möchte auf keinen Fall eine „Vergangenheitsfahrerin“ sein. Du kannst doch nicht nie über irgendetwas reden“, argumentiert die Enkelin, aber vergeblich. Was Fanny jedoch nicht verhindern kann, sind die Erinnerungsschnipsel, die Tag und Nacht auftauchen: „Seit sie die Zeiten nicht mehr im Griff hatte, war sie ihrem Körper auch in dieser Hinsicht ausgeliefert. Heimlich, ohne Fannys Zutun, hatte der Körper über die Jahre alles bewahrt. Und jetzt, da er so schwach war, da Fanny nur noch wenig Nahrung zu sich nahm und der Körper nichts mehr zu tun hatte, waren die Erinnerungen wie organische Prozesse, die eigenständig und ohne willentliche Steuerung vor sich gingen.
Schon Fannys Vater, Bauer in fünfter Generation auf dem Hof in der Senke, war ein Schweiger. Als ihr Bruder Toni nicht aus dem Krieg heimkehrte, verstummte er fast vollständig. Da es nun keinen Hoferben mehr gab und Fannys Mann, der Schulmeister des Dorfes, sich mehr bei Parteisitzungen der Roten und im Wirtshaus als auf dem Hof engagierte, zudem Spielschulden machte, ging der Hof und damit jeglicher Lebensmut der Eltern verloren. Fannys Glück im Schulhaus auf dem Hügel, wo sie sich vorübergehend als Königin fühlte, war von kurzer Dauer. Sie schien das Unglück zeitlebens anzuziehen: „Das Unglück war ein Wesen, das manchmal verschwunden zu sein schien, weit weg und nicht zu sehen, aber es verlor nie die Spur.“ Dabei gab es immer wieder auch glückliche Fügungen in ihrem Leben, Männer, die sie über Jahre begleiteten, Reisen, Freundinnen, eine glimpflich verlaufene Erkrankung, Hanna, die Enkelin – doch die Angst vor dem nächsten Unheil und alte Schuldgefühle dominierten. Anders als der Sohn, der das Trauma der Mutter übernahm, sucht die Enkelin nach einem Weg der Bewältigung.
Als der Debütroman der 1984 geborenen Österreicherin Laura Freudenthaler 2017 im Literaturverlag Droschl erschien, habe ich ihn leider nicht wahrgenommen, obwohl sie dafür den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis 2018 und die Auszeichnung als bestes deutschsprachiges Debüt beim Festival du Premier Roman 2018 in Chambéry erhielt. Nun, mit der Taschenbuchausgabe im Verlag btb, habe ich ihn glücklicherweise entdeckt. Der schmale Band erinnert mich stark an Robert Seethalers Ein ganzes Leben und doch ist die Form der Erinnerungsfetzen, die nur höchstens zwei Seiten umfassen und nahtlos ineinander überzugleiten scheinen, ganz eigen. Mich hat die Geschichte, hinter der ich niemals eine so junge Autorin vermutet hätte, von der ersten Seite an in Bann geschlagen und ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen, nicht nur wegen der aufwühlenden Lebensgeschichte, sondern auch wegen der ruhig fließenden Erzählweise und der Musikalität der Sprache.
Laura Freudenthaler: Die Königin schweigt. btb 2019
www.randomhouse.de


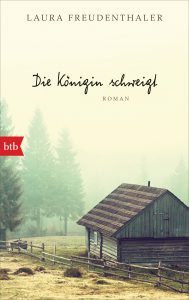

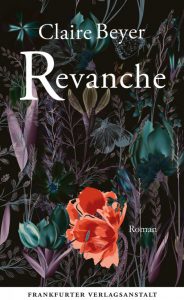 Claire Beyers Debütroman Rauken im Jahr 2000 und zuletzt
Claire Beyers Debütroman Rauken im Jahr 2000 und zuletzt 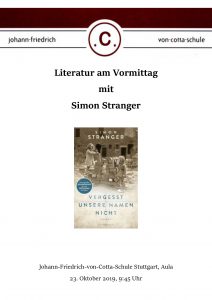





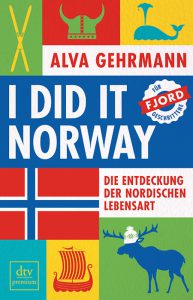 Zu Beginn veranstaltete Alva Gehrmann ein kleines Norwegen-Quiz, bei dem man mit „Kvikk Lunsj“ für richtige Antworten belohnt wurde. Leider war ich vom Gewinn der leckeren Schoko-Keks-Riegel ausgeschlossen, da ich das Quiz bereits im Rahmen einer anderen Veranstaltung mitgemacht hatte. Alva Gehrmanns Norwegen-Buch I did it Norway kannte ich bereits in Teilen, es ist eine unterhaltsame Einführung in Land und Leute. Sehr interressant berichtete sie über das norwegische Literatursystem und das Litteraturhuset in Oslo, wo jedes Jahr auf vier Etagen über 1700 Veranstaltungen stattfinden und Schriftsteller, Übersetzer und Journalisten im „skriveloftet“ unter dem Dach ungestört und in anregender Atmosphäre arbeiten können.
Zu Beginn veranstaltete Alva Gehrmann ein kleines Norwegen-Quiz, bei dem man mit „Kvikk Lunsj“ für richtige Antworten belohnt wurde. Leider war ich vom Gewinn der leckeren Schoko-Keks-Riegel ausgeschlossen, da ich das Quiz bereits im Rahmen einer anderen Veranstaltung mitgemacht hatte. Alva Gehrmanns Norwegen-Buch I did it Norway kannte ich bereits in Teilen, es ist eine unterhaltsame Einführung in Land und Leute. Sehr interressant berichtete sie über das norwegische Literatursystem und das Litteraturhuset in Oslo, wo jedes Jahr auf vier Etagen über 1700 Veranstaltungen stattfinden und Schriftsteller, Übersetzer und Journalisten im „skriveloftet“ unter dem Dach ungestört und in anregender Atmosphäre arbeiten können.