![]() Antons beste Jahre
Antons beste Jahre
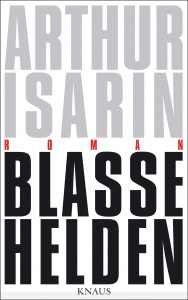
Am 18. März 2018 wurde Wladimir Putin für eine vierte Amtszeit als Präsident der Russischen Föderation wiedergewählt. Angesichts seiner halbdemokratischen, halbautoritären Regierungsweise sprechen westliche Kritiker von Putinismus. Wer verstehen möchte, warum sich dieser ehemalige KBG-Mitarbeiter in Russland großer Zustimmung erfreut, könnte im Roman Blasse Helden des unter Pseudonym schreibenden Arthur Isarin Antworten finden.
In sieben Episoden begleiten wir den Protagonisten Anton durch das Russland der Jahre 1990 bis 1999, dem Jahr, als Putin erstmals als Ministerpräsident vereidigt wurde. Anton ist Deutscher, studierter Ökonom, profunder Kenner und Liebhaber russischer Literatur und Musik und arbeitet in Moskau für einen russischen Kohle- und Stahlkonzern. Zu Beginn 32 Jahre alt, ist er nach Russland gekommen, „um mehr zu erleben als in London oder New York“. Er fühlt sich frei, genießt die Privilegien, die sich für ihn nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auftun, beutet als Parasit das Land aus und „lebt zum ersten Mal nicht mehr vorläufig“: „Diese Stadt war für ihn geschaffen, sie verzieh alles, auch seinen Mangel an Grundsätzen, Substanz und Tiefe.“ Es ist die beste Phase seiner Existenz: „Er fühlte sich wohl in Russland, in seiner überbezahlten Position, die ihm alles ermöglichte, wovon ein zur Faulheit neigender Mann seiner Herkunft mit durchschnittlichen Fähigkeiten nur träumen konnte.“ Für Anton zählt nur das Geld, das er für Frauen, Theater- und Konzertbesuche der ersten Kategorie mit vollen Händen ausgibt. Korruption ist sein alltägliches Geschäft, er interessiert sich nicht für Politik, lebt in einer surrealistisch anmutenden Blase und schaut beim Überlebenskampf der Massen gerne weg. Immerhin hat er einige wenige Grundsätze: Er beteiligt sich nicht am Handel mit Drogen, Waffen und Frauen.
Ich habe mich mit dem Einstieg in diesen Episoden-Roman nicht leichtgetan, denn Isarin setzt eine Menge Wissen um die neuere russische Geschichte und Politik voraus, und auch die Anspielungen auf die russischen Klassiker habe ich mangels Vorkenntnissen leider nicht immer verstanden. Mit zunehmender Lektüre haben mich der Gang der Handlung und die Atmosphäre des Romans aber immer mehr gefesselt, bis zum Ende 1999, als der „blasse Held“ Anton sich entscheiden muss. Das Volk hat endgültig genug von Korruption, der Macht der Oligarchen, dem Krieg im Kaukasus und der Expansion von McDonald’s. Mit dem Aufstieg Putins kommen alte KGB-Funktionäre wieder in Amt und Würden und einer von ihnen stellt Anton vor die Wahl: entweder Teil des neuen, aufsteigenden Russlands und noch reicher werden oder den russischen Traum aufgeben. Für Anton ist es die Entscheidung zwischen Geld und Freiheit.
Auch wenn das Lesen dieses Romans sich für mich manchmal wie Arbeit angefühlt hat, hat sich die Mühe doch eindeutig gelohnt. Neben den Einblicken in die 1990er-Jahre der untergegangenen Sowjetunion habe ich viele Anregungen zum Lesen russischer Klassiker bekommen. Auf einige Sexszenen, vor allem zu Beginn des Romans, hätte ich gerne verzichtet, aber die Ironie Isarins hat mich immer wieder laut auflachen lassen, wenn er beispielsweise die sich nach einem Anschlag in einem Restaurant unter dem Tisch versteckten Gäste beschreibt: „Unter dem Tisch hatte sich eine idyllische Szene entwickelt, die entfernt an Manets ‚Frühstück im Grünen‘ erinnerte.“
Arthur Isarin: Blasse Helden. Knaus 2018
www.randomhouse.de

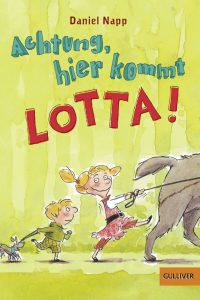
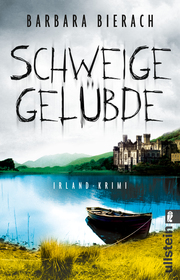 Mit Emma Vaughan, Inspector bei der irischen Polizei im 25 000 Einwohner-Städtchen Sligo an der Westküste, möchte man nicht tauschen. Die alleinerziehende Mutter eines Teenagers hat es schwer, Beruf und Erziehung unter einen Hut zu bringen. Ihr Ex-Mann, von dem sie sich aufgrund häuslicher Gewalt längst hat scheiden lassen, sitzt wegen seiner Vergangenheit bei der IRA in Untersuchungshaft und es droht eine Anklage wegen Terrorismus. Ihm verdankt sie auch ihre Schmerzmittelabhängigkeit, denn die Folgen eines Autounfalls zehn Jahre zuvor bekämpft sie regelmäßig mit Oxycodon, einem verschreibungspflichtigen Medikament, das sie sich auch schon illegal aus der Asservatenkammer beschafft hat. Das ausstehende Ergebnis eines von ihrem Chef angeordneten Drogentests schwebt daher wie ein Damoklesschwert über ihr. Zu allem Überfluss interessiert ihr Kollege James Quinn sich mehr für die junge Empfangssekretärin als für sie und der ungelöste sogenannte Fitzpatrick-Mord an einem protestantischen Vikar, Gegenstand von Band eins, Lügenmauer, hat ihr Kritik und eine Strafversetzung eingebracht. Doch wenigstens die wird aufgehoben, als aus dem Sligo General, dem örtlichen Krankenhaus, ein Hinweis auf verdächtige Todesfälle kommt. Acht Patienten sind dort innerhalb kurzer Zeit ohne diesbezügliche Vorerkrankung an Herzversagen gestorben. Schnell erhärtet sich der Verdacht, dass ein Todesengel am Werk ist, und Emma darf in die Detective Unit zurückkehren.
Mit Emma Vaughan, Inspector bei der irischen Polizei im 25 000 Einwohner-Städtchen Sligo an der Westküste, möchte man nicht tauschen. Die alleinerziehende Mutter eines Teenagers hat es schwer, Beruf und Erziehung unter einen Hut zu bringen. Ihr Ex-Mann, von dem sie sich aufgrund häuslicher Gewalt längst hat scheiden lassen, sitzt wegen seiner Vergangenheit bei der IRA in Untersuchungshaft und es droht eine Anklage wegen Terrorismus. Ihm verdankt sie auch ihre Schmerzmittelabhängigkeit, denn die Folgen eines Autounfalls zehn Jahre zuvor bekämpft sie regelmäßig mit Oxycodon, einem verschreibungspflichtigen Medikament, das sie sich auch schon illegal aus der Asservatenkammer beschafft hat. Das ausstehende Ergebnis eines von ihrem Chef angeordneten Drogentests schwebt daher wie ein Damoklesschwert über ihr. Zu allem Überfluss interessiert ihr Kollege James Quinn sich mehr für die junge Empfangssekretärin als für sie und der ungelöste sogenannte Fitzpatrick-Mord an einem protestantischen Vikar, Gegenstand von Band eins, Lügenmauer, hat ihr Kritik und eine Strafversetzung eingebracht. Doch wenigstens die wird aufgehoben, als aus dem Sligo General, dem örtlichen Krankenhaus, ein Hinweis auf verdächtige Todesfälle kommt. Acht Patienten sind dort innerhalb kurzer Zeit ohne diesbezügliche Vorerkrankung an Herzversagen gestorben. Schnell erhärtet sich der Verdacht, dass ein Todesengel am Werk ist, und Emma darf in die Detective Unit zurückkehren.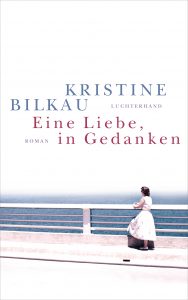
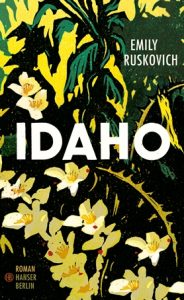 Dreh- und Angelpunkt des Debütromans Idaho der jungen US-Amerikanerin Emily Ruskovich ist eine Familientragödie. Im August 1995 unternimmt die Familie Mitchell, Vater Wade, Mutter Jenny sowie die sechs- und neunjährigen Töchter May und June, im Pick-up einen Ausflug zum Mount Loeil, um Holz für den Winter zu machen. Völlig unvermittelt erschlägt die Mutter May mit einem Axthieb, June flüchtet in den Wald und bleibt verschollen.
Dreh- und Angelpunkt des Debütromans Idaho der jungen US-Amerikanerin Emily Ruskovich ist eine Familientragödie. Im August 1995 unternimmt die Familie Mitchell, Vater Wade, Mutter Jenny sowie die sechs- und neunjährigen Töchter May und June, im Pick-up einen Ausflug zum Mount Loeil, um Holz für den Winter zu machen. Völlig unvermittelt erschlägt die Mutter May mit einem Axthieb, June flüchtet in den Wald und bleibt verschollen.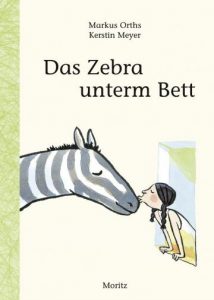 Aufgepasst: Falls es unter dem Hochbett niest und hustet, könnte ein Zebra ins Zimmer geklettert sein. Jedenfalls ist das bei Hanna so, die gerade mit ihren beiden Papas, Papa Paul und Papa Konrad, umgezogen ist und in ihrer neuen Schule die zweite Klasse besucht. Da sie sich dort noch ziemlich einsam fühlt, kommt Bräuninger, so der Name des sprechenden Zebras, gerade recht, denn so braucht sie ihre Papas für Schulweg nicht mehr. Doch während sich die Klassenkameraden über den Vierbeiner freuen, sind die Lehrerin und der verbiesterte Direktor trotz dessen offensichtlicher Begabung für Rechnen, Schreiben, Turnen und Fantasiereisen und seiner problemlosen Eingliederung in die Klasse gar nicht begeistert. Schließlich sieht die Schulordnung ein sprechendes Zebra nicht vor!
Aufgepasst: Falls es unter dem Hochbett niest und hustet, könnte ein Zebra ins Zimmer geklettert sein. Jedenfalls ist das bei Hanna so, die gerade mit ihren beiden Papas, Papa Paul und Papa Konrad, umgezogen ist und in ihrer neuen Schule die zweite Klasse besucht. Da sie sich dort noch ziemlich einsam fühlt, kommt Bräuninger, so der Name des sprechenden Zebras, gerade recht, denn so braucht sie ihre Papas für Schulweg nicht mehr. Doch während sich die Klassenkameraden über den Vierbeiner freuen, sind die Lehrerin und der verbiesterte Direktor trotz dessen offensichtlicher Begabung für Rechnen, Schreiben, Turnen und Fantasiereisen und seiner problemlosen Eingliederung in die Klasse gar nicht begeistert. Schließlich sieht die Schulordnung ein sprechendes Zebra nicht vor!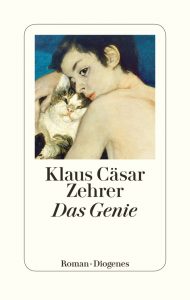
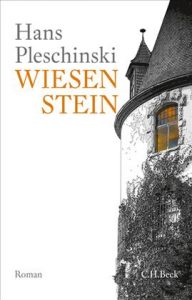 Wiesenstein heißt die herrschaftliche Villa Gerhart Hauptmanns im niederschlesischen Agnetendorf, abgebildet auf dem stilvollen Cover, wo der Dichter seine letzten Lebensmonate im Kreise seiner zweiten Frau Margarete und seiner Angestellten verbrachte. Zugleich ist es der Titel von Hans Pleschinskis Romanbiografie über Hauptmann, der zu seiner Zeit berühmter und reicher war als sein Dauerkonkurrent Thomas Mann. Letzterem hat Pleschinski vor einigen Jahren mit dem Roman Königsallee ein Denkmal gesetzt. Die Spannungen zwischen den beiden Rivalen mündeten im Abbild Hauptmanns als lächerlicher Mynheer Peeperkorn in Der Zauberberg, was dieser zeitlebens übelnahm.
Wiesenstein heißt die herrschaftliche Villa Gerhart Hauptmanns im niederschlesischen Agnetendorf, abgebildet auf dem stilvollen Cover, wo der Dichter seine letzten Lebensmonate im Kreise seiner zweiten Frau Margarete und seiner Angestellten verbrachte. Zugleich ist es der Titel von Hans Pleschinskis Romanbiografie über Hauptmann, der zu seiner Zeit berühmter und reicher war als sein Dauerkonkurrent Thomas Mann. Letzterem hat Pleschinski vor einigen Jahren mit dem Roman Königsallee ein Denkmal gesetzt. Die Spannungen zwischen den beiden Rivalen mündeten im Abbild Hauptmanns als lächerlicher Mynheer Peeperkorn in Der Zauberberg, was dieser zeitlebens übelnahm.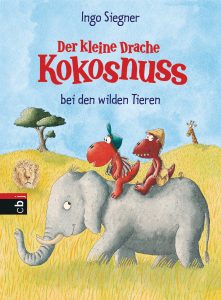
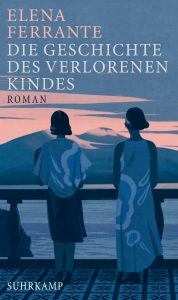 Mit Bedauern und ein bisschen Wehmut habe ich nach gut 2200 Seiten den vierten und letzten Band von Elena Ferrantes Neapolitanischer Saga zugeklappt. Von der Kindheit in den 1950er-Jahren an habe ich die beiden ungleichen Freundinnen Elena und Lila bis etwa 2010 begleitet, als Lila ihr lange angekündigtes Verschwinden in die Tat umsetzte. Den ersten Band, Meine geniale Freundin, über die Kindheit der beiden habe ich verschlungen und auch Band zwei, Die Geschichte eines neuen Namens, hat mir ausgezeichnet gefallen. Bei Band drei, Die Geschichte der getrennten Wege, der größtenteils nicht in Neapel spielt, habe ich mich aufgrund einiger Längen etwas schwerer getan, aber mit Band vier, Die Geschichte des verlorenen Kindes, ist Elena Ferrante in meinen Augen ein ausgezeichneter Abschluss gelungen. Das liegt vor allem daran, dass mit der Rückkehr Elenas zunächst nach Neapel, dann sogar in den Rione, alle früheren Fäden wiederaufgenommen werden und man erfährt, wie es den Kameraden aus der Kindheit weiter erging. Außerdem bewegt in diesem Teil Lilas Schicksal tief, ihr nach einem großen Unglück unstillbarer Schmerz, der letztlich in ihr (fast) vollkommenes Verschwinden mündet.
Mit Bedauern und ein bisschen Wehmut habe ich nach gut 2200 Seiten den vierten und letzten Band von Elena Ferrantes Neapolitanischer Saga zugeklappt. Von der Kindheit in den 1950er-Jahren an habe ich die beiden ungleichen Freundinnen Elena und Lila bis etwa 2010 begleitet, als Lila ihr lange angekündigtes Verschwinden in die Tat umsetzte. Den ersten Band, Meine geniale Freundin, über die Kindheit der beiden habe ich verschlungen und auch Band zwei, Die Geschichte eines neuen Namens, hat mir ausgezeichnet gefallen. Bei Band drei, Die Geschichte der getrennten Wege, der größtenteils nicht in Neapel spielt, habe ich mich aufgrund einiger Längen etwas schwerer getan, aber mit Band vier, Die Geschichte des verlorenen Kindes, ist Elena Ferrante in meinen Augen ein ausgezeichneter Abschluss gelungen. Das liegt vor allem daran, dass mit der Rückkehr Elenas zunächst nach Neapel, dann sogar in den Rione, alle früheren Fäden wiederaufgenommen werden und man erfährt, wie es den Kameraden aus der Kindheit weiter erging. Außerdem bewegt in diesem Teil Lilas Schicksal tief, ihr nach einem großen Unglück unstillbarer Schmerz, der letztlich in ihr (fast) vollkommenes Verschwinden mündet.