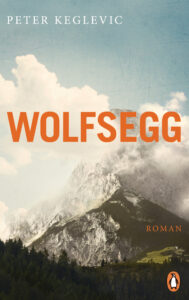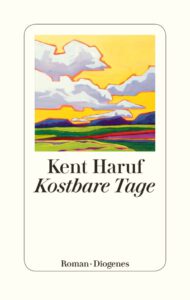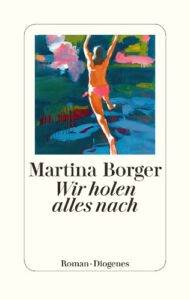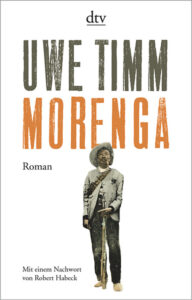Weggesperrt und für verrückt erklärt
Weggesperrt und für verrückt erklärt
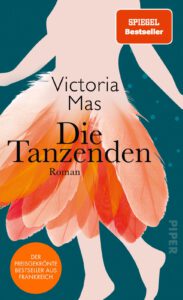
Den Roman Själarnas Ö von Johanna Holmström, in deutscher Übersetzung als Die Frauen von Själö erschienen, habe ich 2019 mit großer Anteilnahme gelesen. Darin geht es um eine Insel im äußeren Schärengürtel vor Turku, auf der es bis 1962 eine Nervenheilanstalt für Frauen gab. Meist wurden sie von ihren Angehörigen eingewiesen, häufig nicht mit einer psychiatrischen Diagnose, sondern wegen Rebellion gegen gesellschaftliche Konventionen.
Eine ganze Reihe von Parallelen dazu weist das preisgekrönte Debüt Die Tanzenden der 1987 geborenen Französin Victoria Mas auf, das im Hôpital de la Salpêtrière in Paris spielt, einer der berühmtesten Nervenheilanstalten der Zeit. In beiden Romanen stehen je zwei Patientinnen und eine Krankenschwester im Zentrum, beide beschäftigen sich mit den Einweisungsgründen und dem Klinikalltag und in beiden leben nur wenige Patientinnen freiwillig, weil ihnen die Einrichtung Schutz vor meist männlicher Gewalt bietet. Doch während die Handlung in Själarnas Ö von 1891 bis in die 1930er-Jahre spielt, umfasst sie in Die Tanzenden lediglich zwei Wochen im Februar und März 1885 mit einem Epilog 1890. Abgeschottet lebten die Patientinnen hier wie dort, doch gab es in der Salpêtrière zahlreiche Ärzte, an der Spitze 1885 der berühmte Professor Charcot mit seiner Hypnosetherapie, der mit ausgewählten Patientinnen wöchentliche öffentliche Lehrvorstellungen gab. Höhepunkt des Jahres für die Salpêtrière wie für die Pariser Bourgeoisie war der jährlich zu Mittfasten abgehaltene Kostümball, der „Bal des folles“, bei dem man die „Hysterikerinnen“ einem sensationsgierigen Publikum präsentierte.
Zwei Patientinnen, eine Krankenschwester
Während Sigrid, die Krankenschwester auf Själö, ihre Patientinnen empathisch umsorgt und die Grenzen zwischen krank und gesund ständig infrage stellt, ist Geneviève, die ehrgeizige Oberaufseherin der Salpêtrière, distanziert und zweifelt nicht am Konzept ihrer Klinik. Louise, eine 16-jährige Waise, wurde drei Jahre zuvor von ihrer Tante nach dem Missbrauch durch ihren Onkel eingeliefert. Ebenfalls Opfer ihrer Familie ist die rebellische 19-jährige Eugénie aus bürgerlichem Haus, die mit ihrer Geisterseherei eine Bedrohung darstellt:
Dass sie Verstorbene sah, war ein untrügliches Anzeichen von Wahnsinn. Derlei Symptome führten eine Frau, das wusste Eugénie, nicht zum Arzt, sondern geradewegs in die Salpêtrière. Wer solche Dinge öffentlich erwähnte, dem war die Zwangseinweisung sicher. (S. 54)
Als Eugénie sich trotzdem ihrer Großmutter anvertraut, bringt ihr Vater sie umgehend in die berüchtigte Klinik. Nicht nur für Eugénie ist das ein dramatischer Einschnitt, sondern auch für Geneviève, die durch die Geisterseherin in ihren Grundfesten erschüttert wird:
Seit einer Woche, seit Eugénie da ist, entgleitet ihr alles, was sie im Griff zu haben meinte. Ein bedrückendes Gefühl, doch sie wehrt sich nicht mehr dagegen. Sie hat versucht, standhaft zu bleiben – umsonst. (S. 136)
Ein zwiespältiges Fazit
Einerseits ist die Geschichte äußerst spannend, gut recherchiert, die Ausrichtung auf den dramaturgischen Höhepunkt in der Ballnacht gelungen. Man merkt, wie sehr die Autorin für ihr Thema und die unterdrückten Frauen brennt. Der Erzählstil ist einfach, der Roman liest sich dank des fast konsequent chronologischen Aufbaus leicht und das Cover ist wunderschön. Leider hat mir aber das Abgleiten ins Okkulte und Spiritistische überhaupt nicht gefallen, weil es einer ansonsten realistischen Handlung die Glaubwürdigkeit raubt. Von der Lektüre abraten möchte ich trotzdem nicht, dazu hat mich der historische Hintergrund zu sehr gefesselt und das Geschehen abseits der Geistergeschichte zu gut unterhalten.
Victoria Mas: Die Tanzenden. Aus dem Französischen von Julia Schoch. Piper 2020
www.piper.de

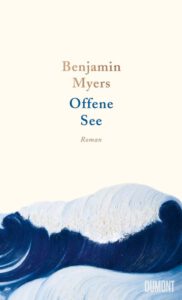
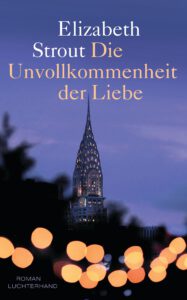
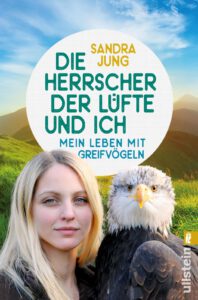

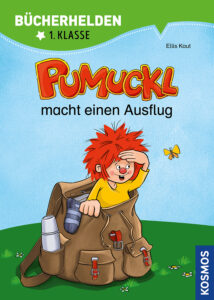
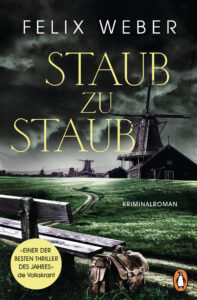 Ein geistig behinderter Junge namens Siebold Tammens rettet Siem Coburg gleich zwei Mal das Leben. Beim ersten Mal lenkt das Kind durch sein schrilles, unkontrolliertes Kreischen die „Moffen“, niederländisches Schimpfwort für die Deutschen im Zweiten Weltkrieg und Synonym für Nazis, von ihrer Suche nach Coburg ab, der sich als Widerstandskämpfer auf dem Bauernhof von Siebolds Großvater versteckt. Beim zweiten Mal holt die Bitte von Siebolds Großvater, dem Tod des knapp Siebzehnjährigen auf den Grund zu gehen, den lebensmüden, vom Krieg gezeichneten Coburg wieder ins Leben zurück. Siebold, den der Großvater inzwischen schweren Herzens im Kloster Sint Norbertus bei Venlo untergebracht hatte, war dort unter ungeklärten Umständen verstorben. Nicht der einzige Todesfall bei den mehr als 400 Patienten, die von nur 20 Mönchen und wenigen Laien völlig unterversorgt sind. Besonders im Pavillon für die schweren Fälle, in dem einzig ein junger Mönch als ungelernte Pflegekraft 36 schwerstbehinderte Kinder auf engstem Raum betreut, kam es vermehrt zu Todesfällen. Wunschgemäß beginnt Siem Coburg im Kloster selbst und in dessen Umgebung zu recherchieren. Keine leichte Aufgabe, denn nicht nur innerhalb der Klostermauern herrscht striktes Schweigen:
Ein geistig behinderter Junge namens Siebold Tammens rettet Siem Coburg gleich zwei Mal das Leben. Beim ersten Mal lenkt das Kind durch sein schrilles, unkontrolliertes Kreischen die „Moffen“, niederländisches Schimpfwort für die Deutschen im Zweiten Weltkrieg und Synonym für Nazis, von ihrer Suche nach Coburg ab, der sich als Widerstandskämpfer auf dem Bauernhof von Siebolds Großvater versteckt. Beim zweiten Mal holt die Bitte von Siebolds Großvater, dem Tod des knapp Siebzehnjährigen auf den Grund zu gehen, den lebensmüden, vom Krieg gezeichneten Coburg wieder ins Leben zurück. Siebold, den der Großvater inzwischen schweren Herzens im Kloster Sint Norbertus bei Venlo untergebracht hatte, war dort unter ungeklärten Umständen verstorben. Nicht der einzige Todesfall bei den mehr als 400 Patienten, die von nur 20 Mönchen und wenigen Laien völlig unterversorgt sind. Besonders im Pavillon für die schweren Fälle, in dem einzig ein junger Mönch als ungelernte Pflegekraft 36 schwerstbehinderte Kinder auf engstem Raum betreut, kam es vermehrt zu Todesfällen. Wunschgemäß beginnt Siem Coburg im Kloster selbst und in dessen Umgebung zu recherchieren. Keine leichte Aufgabe, denn nicht nur innerhalb der Klostermauern herrscht striktes Schweigen: