![]() Wenn die Zeit die Wunden nicht heilt
Wenn die Zeit die Wunden nicht heilt
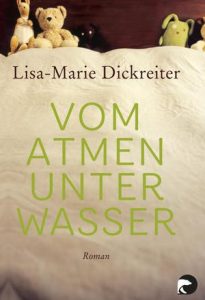 Vor einigen Monaten habe ich Justins Heimkehr des US-Amerikaners Bret Anthony Johnston gelesen, in dem ein entführter Elfjähriger nach vier Jahren plötzlich wieder auftaucht. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die kriminelle Tat, sondern das Innenleben der Familie vor und nach seiner Heimkehr.
Vor einigen Monaten habe ich Justins Heimkehr des US-Amerikaners Bret Anthony Johnston gelesen, in dem ein entführter Elfjähriger nach vier Jahren plötzlich wieder auftaucht. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die kriminelle Tat, sondern das Innenleben der Familie vor und nach seiner Heimkehr.
Im Debütroman der 1978 geborenen Autorin Lisa-Marie Dickreiter Vom Atmen unter Wasser gibt es keine glückliche Heimkehr, jedoch weist die gewählte Perspektive trotz aller Unterschiede gewisse Parallelen auf. Die 16-jährige Tochter Sarah der Freiburger Familie Bergmann ist vor einem knappen Jahr auf dem Nachhauseweg von einer Party ermordet worden, zurück bleiben die Eltern Anne und Jo und der ältere Bruder Simon, die in ihrer Trauer jedoch nicht zueinander finden, sondern sich immer mehr voneinander entfernen. Nach diesem ersten Jahr begeht Anne einen erfolglosen Suizidversuch, denn die wohlmeinenden Versprechungen „Die Zeit heilt alle Wunden“, „Die Zeit wird euch helfen“ oder „Die Zeit arbeitet für euch“ sind nicht eingetreten. Sie kann nicht mehr in ihrem Beruf als Krankenschwester arbeiten aus Angst, „dass eines Tages ein Mädchen kommt, das überlebt“, joggt bis zur Erschöpfung, bricht trotz ihrer Instabilität eine Therapie ab und schläft im Bett der Tochter. Sie leidet darunter, dass Sarah jeden Tag mehr aus ihrem Leben verschwindet und beschuldigt Jo und Simon, ihr Sarah wegnehmen zu wollen. Selbstvorwürfe quälen sie, weil sie zunächst kein zweites Kind wollte: „Ich habe sie nicht genug gewollt. Deswegen ist sie mir weggenommen worden.“ Ihre Recherchen über die letzten Stunden im Leben ihrer Tochter werden zur Obsession. Gleichzeitig beschuldigt sie ihren Mann, einen Sozialarbeiter, der ihr weniger unter dem Verlust zu leiden scheint: „Dir ist doch alles egal! Du lebst dein schieß Leben weiter, als wäre nichts passiert!“, doch auch Jo leidet auf seine Weise. Im Gegensatz zu seiner Frau versucht er, mit Aktionismus über die Trauer hinwegzukommen: „Anne, das Leben geht weiter! Und die Müllabfuhr kommt morgen trotzdem, ob’s uns nun passt oder nicht.“ Er hat nicht nur seine Tochter, sondern auch seine Frau verloren. Simon dagegen, der Medizinstudent, der in der Familie immer nur zweite Wahl hinter Sarah war, zieht auf Wunsch des Vaters nach Annes Selbstmordversuch wieder zuhause ein, um die Mutter unter Kontrolle zu haben. Auch er kämpft mit seinen Dämonen, denn er stand Sarah nicht besonders nah und ist überzeugt: „Wenn Sarah noch am Leben wäre und ich tot, dann hätte sie nicht versucht, sich umzubringen.“
Vom Atmen unter Wasser war für mich nicht nur wegen des für Eltern fast unerträglichen Themas, sondern auch wegen des emotional schwer auszuhaltenden, sehr intensiven und beklemmenden Stils eine Herausforderung. Die Erzählweise im Präsens unterstreicht den nicht nachlassenden Schmerz und die grenzenlose Einsamkeit der drei übriggebliebenen Familienmitglieder nachdrücklich, die kurzen Sätze vermitteln eine Form von Atemlosigkeit. Abwechselnd erzählt Lisa-Marie Dickreiter in personaler Form über die drei Protagonisten, wobei jeweils der Name als Kapitelüberschrift dient.
Als Außenstehende hätte ich erwartet und mir natürlich auch gewünscht, dass Anne, Jo und Simon in dieser schwierigen Situation anders miteinander umgehen, zueinander finden, sich gegenseitig stützen und Trost spenden können, doch leider ist das Gegenteil hier der Fall. Langsam und zunächst widerstrebend habe ich mich im Laufe der Geschichte mit dem Gedanken angefreundet, dass getrennte Wege manchmal die bessere Alternative sind. Denn erst dadurch kommt am Ende doch noch so etwas wie Hoffnung auf eine vielleicht wieder freiere Atmung auf.
Nicht besonders angenehm zu lesen finde ich die Taschenbuchausgabe des Verlags Bloomsbury, die sich der Lektüre förmlich zu widersetzen scheint und entweder brutal „aufgebrochen“ oder mit zwei Händen gelesen werden muss.
Lisa-Marie Dickreiter: Vom Atmen unter Wasser. Bloomsbury Verlag 2012
www.piper.de/berlin-verlag

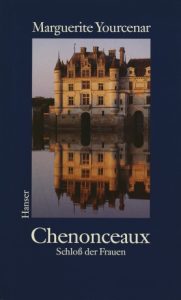 Chenonceaux – Schloß der Frauen der französischen Historikerin und Literaturwissenschaftlerin Marguerite Yourcenar (1903 – 1987) erschien ursprünglich 1978 in einem Essayband unter dem Titel Ah, mon beau château und setzt dem traumhaften Wasserschloss mit seiner berühmten Brückengalerie über den Cher und den Frauen, die hier als Bauherrinnen wirkten und darin lebten, ein bezauberndes Andenken. Ich weiß allerdings nicht, warum Marguerite Yourcenar konsequent „Chenonceaux“ schreibt, laut meinen Quellen verfügt nur der Ort über ein „x“ am Ende, das Schloss dagegen heißt „Chenonceau“.
Chenonceaux – Schloß der Frauen der französischen Historikerin und Literaturwissenschaftlerin Marguerite Yourcenar (1903 – 1987) erschien ursprünglich 1978 in einem Essayband unter dem Titel Ah, mon beau château und setzt dem traumhaften Wasserschloss mit seiner berühmten Brückengalerie über den Cher und den Frauen, die hier als Bauherrinnen wirkten und darin lebten, ein bezauberndes Andenken. Ich weiß allerdings nicht, warum Marguerite Yourcenar konsequent „Chenonceaux“ schreibt, laut meinen Quellen verfügt nur der Ort über ein „x“ am Ende, das Schloss dagegen heißt „Chenonceau“.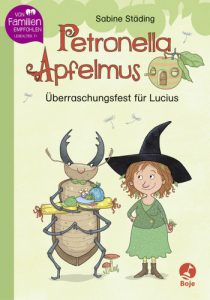 Lucius, Hirschkäfer und bester Freund der Apfelhexe Petronella Apfelmus, die in ihrem Apfelhaus im Garten der alten Mühle wohnt, hat Geburtstag und Petronella möchte eine Geburtstags-Überraschungsparty mit allen Freunden und Geschwistern für ihn ausrichten. Doch bevor das wunderbare Fest am Ende des Mühlteichs mit runzligen Nussweibchen, moosgrünen Waldkobloden, Gartenzwergen, Rennschnecken, Apfelmännchen, Hirschkäfern und den kleingezauberten Zwillingen Lea und Luis losgehen kann, bringt Petronella sich mit einer Unachtsamkeit beim Hexen in eine verzwickte Lage. Ein Glück, dass Lea und Luis so clever sind und bereits lesen können!
Lucius, Hirschkäfer und bester Freund der Apfelhexe Petronella Apfelmus, die in ihrem Apfelhaus im Garten der alten Mühle wohnt, hat Geburtstag und Petronella möchte eine Geburtstags-Überraschungsparty mit allen Freunden und Geschwistern für ihn ausrichten. Doch bevor das wunderbare Fest am Ende des Mühlteichs mit runzligen Nussweibchen, moosgrünen Waldkobloden, Gartenzwergen, Rennschnecken, Apfelmännchen, Hirschkäfern und den kleingezauberten Zwillingen Lea und Luis losgehen kann, bringt Petronella sich mit einer Unachtsamkeit beim Hexen in eine verzwickte Lage. Ein Glück, dass Lea und Luis so clever sind und bereits lesen können!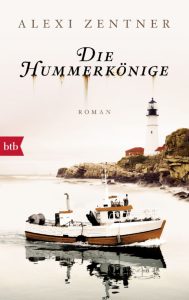 Fast wie Könige herrschen die Mitglieder der Familie Kings über die fiktive 2000-Einwohnerinsel Loosewood Island vor der Küste von Nova Scotia, Kanada, und Maine, USA. Schon immer gab es Grenzstreitigkeiten und die Insel ist inzwischen eine Art Niemandsland, von dem ich nicht weiß, ob es so etwas tatsächlich gibt. Erster ständiger Bewohner war vor etwa 300 Jahren Brumfitt Kings, ein Hummerfischer und bis heute berühmter Maler, der ein wertvolles Werk und bei Kunstwissenschaftlern gegehrte Tagebücher hinterlassen hat. Ihm und der rauen, ursprünglichen Natur sind die Touristen zu verdanken. Viele Legenden ranken sich um Brumfitt Kings Leben, vor allem die um seine Frau, die ein Geschenk des Meeres gewesen sein soll, die den Reichtum des Meeres als Mitgift in die Ehe gebracht hat, für den allerdings bis heute jeweils der älteste Sohn jeder Generation als Tribut gezahlt werden muss.
Fast wie Könige herrschen die Mitglieder der Familie Kings über die fiktive 2000-Einwohnerinsel Loosewood Island vor der Küste von Nova Scotia, Kanada, und Maine, USA. Schon immer gab es Grenzstreitigkeiten und die Insel ist inzwischen eine Art Niemandsland, von dem ich nicht weiß, ob es so etwas tatsächlich gibt. Erster ständiger Bewohner war vor etwa 300 Jahren Brumfitt Kings, ein Hummerfischer und bis heute berühmter Maler, der ein wertvolles Werk und bei Kunstwissenschaftlern gegehrte Tagebücher hinterlassen hat. Ihm und der rauen, ursprünglichen Natur sind die Touristen zu verdanken. Viele Legenden ranken sich um Brumfitt Kings Leben, vor allem die um seine Frau, die ein Geschenk des Meeres gewesen sein soll, die den Reichtum des Meeres als Mitgift in die Ehe gebracht hat, für den allerdings bis heute jeweils der älteste Sohn jeder Generation als Tribut gezahlt werden muss.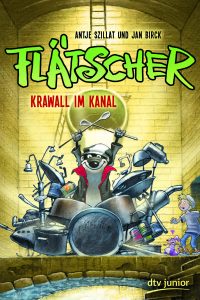 Er ist wieder da: Flätscher, das Stinktier mit der zeitweisen Ladehemmung, selbsternannter Meisterdetektiv mit Riesenklappe und noch größerem Herzen und mit einer Schwäche für Semmelknödel und die unwiderstehlich mit den Augen klimpernde Wieseldame Cloe.
Er ist wieder da: Flätscher, das Stinktier mit der zeitweisen Ladehemmung, selbsternannter Meisterdetektiv mit Riesenklappe und noch größerem Herzen und mit einer Schwäche für Semmelknödel und die unwiderstehlich mit den Augen klimpernde Wieseldame Cloe.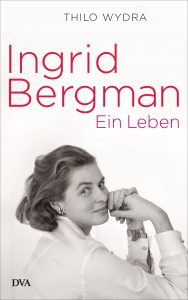
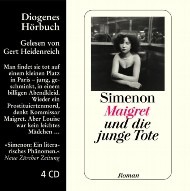 Kaum zu glauben, aber dieses Hörbuch mit dem legendären Kommissar Maigret war tatsächlich meine erste Begegnung mit dem weltberühmten Pariser Ermittler, allerdings sicher nicht meine letzte!
Kaum zu glauben, aber dieses Hörbuch mit dem legendären Kommissar Maigret war tatsächlich meine erste Begegnung mit dem weltberühmten Pariser Ermittler, allerdings sicher nicht meine letzte!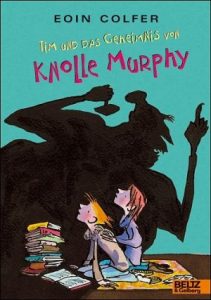 Als der Vater wieder einmal nach Hause kommt und drei eigene und vier fremde Kinder in Kriegsbemalung an den Vorhängen hängen, ist das Maß voll. Die Eltern beschließen, dass in diesem Haushalt mit fünf Söhnen unter elf Jahren etwas passieren muss und sie verordnen den beiden ältesten, Tim und Marty, eine „bildende Beschäftigung außer Haus für die Ferien“. Im Klartext bedeutet das regelmäßige Nachmittage in der Stadtbibliothek unter den Augen der berüchtigten Bibliothekarin Miss Murphy, „Knolle Murphy“ genannt, einem gefürchteten Kinderschreck, gruselig abgebildet auf dem Cover als schwarzer Schatten. Alle Gegenwehr nützt nichts, und so treten die beiden Brüder wohl oder übel diese vermeintliche Höchststrafe an.
Als der Vater wieder einmal nach Hause kommt und drei eigene und vier fremde Kinder in Kriegsbemalung an den Vorhängen hängen, ist das Maß voll. Die Eltern beschließen, dass in diesem Haushalt mit fünf Söhnen unter elf Jahren etwas passieren muss und sie verordnen den beiden ältesten, Tim und Marty, eine „bildende Beschäftigung außer Haus für die Ferien“. Im Klartext bedeutet das regelmäßige Nachmittage in der Stadtbibliothek unter den Augen der berüchtigten Bibliothekarin Miss Murphy, „Knolle Murphy“ genannt, einem gefürchteten Kinderschreck, gruselig abgebildet auf dem Cover als schwarzer Schatten. Alle Gegenwehr nützt nichts, und so treten die beiden Brüder wohl oder übel diese vermeintliche Höchststrafe an.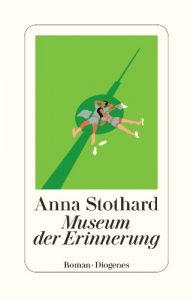 Anna Stothards Roman Museum der Erinnerung erinnert an einen zunächst leeren Zeitstrahl, der sich im Laufe der 300 zu lesenden Seiten nach und nach mit einzelnen Daten und Ereignissen füllt, über die ich hier allerdings aus Gründen der Spannung so wenig wie möglich verraten möchte.
Anna Stothards Roman Museum der Erinnerung erinnert an einen zunächst leeren Zeitstrahl, der sich im Laufe der 300 zu lesenden Seiten nach und nach mit einzelnen Daten und Ereignissen füllt, über die ich hier allerdings aus Gründen der Spannung so wenig wie möglich verraten möchte.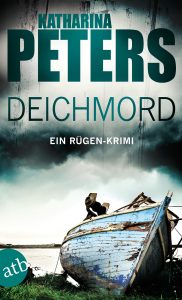 Eine anonyme Terrorwarnung per Mail hält die Kommissariate in Bergen und Stralsund vorübergehend in Atem, doch finden Romy Beccare und ihr Team in Bergen genauso wie die Ermittlergruppe um ihren Lebenspartner Jan Riechter, leitender Kommissar in Stralsund, keinen Anhaltspunkt für einen geplanten Terroranschlag durch einen Ralswieker Hotelier. Aber ganz mag Romy, beharrlich wie sie nun einmal ist, die Nachforschungen nicht einstellen, und stößt unvermutet auf zwei ungeklärte Vermisstenfälle aus den Jahren 1990 und 1993. Beide verschwundene Studentinnen waren zuletzt im Gästehaus Magold in Ralswiek abgestiegen, das inzwischen der wegen einer Schussverletzung aus dem Dienst ausgeschiedenen Ex-Polizist Rolf Magold führt. Auch die 1999 ermordete 21-jährige Karin Maier hat dort zuletzt als Zimmermädchen gearbeitet, allerdings wurde für diese Tat ein einschlägig bekannter Sexualstraftäter verurteilt. Als dann auch noch im Zusammenhang mit einem aktuellen weiblichen Leichenfund auf einer stillgelegten Deponie der Name Magold fällt, leuchten nicht nur bei Romy alle Alarmglocken…
Eine anonyme Terrorwarnung per Mail hält die Kommissariate in Bergen und Stralsund vorübergehend in Atem, doch finden Romy Beccare und ihr Team in Bergen genauso wie die Ermittlergruppe um ihren Lebenspartner Jan Riechter, leitender Kommissar in Stralsund, keinen Anhaltspunkt für einen geplanten Terroranschlag durch einen Ralswieker Hotelier. Aber ganz mag Romy, beharrlich wie sie nun einmal ist, die Nachforschungen nicht einstellen, und stößt unvermutet auf zwei ungeklärte Vermisstenfälle aus den Jahren 1990 und 1993. Beide verschwundene Studentinnen waren zuletzt im Gästehaus Magold in Ralswiek abgestiegen, das inzwischen der wegen einer Schussverletzung aus dem Dienst ausgeschiedenen Ex-Polizist Rolf Magold führt. Auch die 1999 ermordete 21-jährige Karin Maier hat dort zuletzt als Zimmermädchen gearbeitet, allerdings wurde für diese Tat ein einschlägig bekannter Sexualstraftäter verurteilt. Als dann auch noch im Zusammenhang mit einem aktuellen weiblichen Leichenfund auf einer stillgelegten Deponie der Name Magold fällt, leuchten nicht nur bei Romy alle Alarmglocken…