![]() Leider ein bisschen zuviel von allem
Leider ein bisschen zuviel von allem
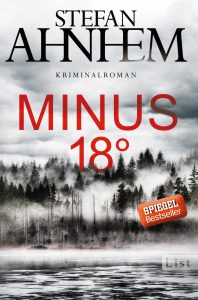 Minus 18° war mein erster Krimi des hochgelobten schwedischen Autors Stefan Ahnhem, obwohl es sich dabei schon um Band drei der Fabian-Risk-Serie handelt, und es wäre sicher einfacher gewesen, wenn ich Herzsammler sowie Und morgen du bereits gekannt hätte. Aber auch so war der Einstieg möglich und Andeutungen bzgl. der Vorgängerbände haben meine Neugier auf die Vorgeschichte geweckt.
Minus 18° war mein erster Krimi des hochgelobten schwedischen Autors Stefan Ahnhem, obwohl es sich dabei schon um Band drei der Fabian-Risk-Serie handelt, und es wäre sicher einfacher gewesen, wenn ich Herzsammler sowie Und morgen du bereits gekannt hätte. Aber auch so war der Einstieg möglich und Andeutungen bzgl. der Vorgängerbände haben meine Neugier auf die Vorgeschichte geweckt.
Alles beginnt in Helsingborg, der Stadt im südschwedischen Schonen, als der Fahrer eines BMW nach einer wilden Verfolgungsjagd mit der Chefin des örtlichen Kommissariats wegen eines abgefahrenen Außenspiegels über die Kaimauer in Norra Hamn rast und zu Tode kommt. Dieser Fall, der eine lange Flaute beim örtlichen Ermittlerteam beendet, wird interessant durch die unglaubliche Feststellung des Rechtsmediziners, dass der Tote auf dem Fahrersitz, der schwerreiche IT-Unternehmer Peter Brise, bereits seit ungefähr zwei Monaten tot und seither tiefgefroren war. Doch was ist mit der Aussage von Zeugen, die ihn zuletzt noch getroffen haben? Was als tragischer Verkehrsunfall begann, wird für das Helsingborger Ermittlungsteam und den sympathischen Fabian Risk nach und nach zu einem Fall nie dagewesenen Ausmaßes, zu einem Alptraum an Brutalität. Nicht nur, dass ein 18 Monate zuvor fälschlicherweise als Selbstmord zu den Akten gelegter Todesfall den oder dem Täter zugeordnet werden muss, steht die Befürchtung im Raum, dass weitere Opfer folgen werden. Und nicht nur sie schweben in Todesgefahr, jeder und jede, die dem oder den Tätern zu nahekommen, wird brutal ermordet, so dass es schnell jede Menge Leichen gibt.
Parallel zur Mordserie in Helsingborg bekommt es auf der anderen Seite des Öresunds im benachbarten Dänemark die zum Streifendienst degradierte Ermittlerin Dunja Hougaard mit einem Fall von „Happy Slapping“ zu tun, bei dem Jugendliche vor laufender Handykamera Obdachlose hinrichten und die Filme anschließend ins Netz stellen.
Minus 18° ist zweifellos ein sehr spannender Krimi, den auch ich kaum aus der Hand legen konnte, doch wirklich überzeugt hat er mich trotzdem nicht. Neben der unglaublichen Gewalt hat Stefan Ahnhem für meinen Geschmack auch viel zu viel in diese 550 Seiten hineingepackt. So hat nicht nur Fabian Risk ein breiten Raum einnehmendes Privatleben mit Problemen, über die man fast schon einen eigenen Roman schreiben könnte, seine Chefin trinkt nach ihrer Scheidung, die dänische Kollegin führt einen Privatkrieg gegen einen ehemaligen Vorgesetzten, ein Kollege nimmt sich anscheinend das Leben und eine ehemalige Kollegin leidet noch immer unter den Folgen eines Einsatzfehlers von Risk. Positiv ist dabei allerdings zu vermerken, dass man als Leser trotz aller Orts- und Perspektivwechsel nie den Faden verliert, was für Ahnhems Können spricht. Das an sich hochspannende, zentrale Thema „Identitätsdiebstahl“ wird allerdings durch die schiere Anzahl der Fälle ebenfalls überstrapaziert und verliert dadurch im Laufe des Krimis immer mehr an Glaubwürdigkeit. Hier wie bei den Nebenhandlungen wäre für mich weniger eindeutig mehr gewesen. Schade, denn die leider aus dem realen Leben stammenden Themen und das überwiegend sympathische Personal hätten mehr Potential gehabt.
Ich werde trotzdem mit Herzsammler noch einen weiteren Versuch machen. Ob ich allerdings den Folgeband lese, muss ich mir trotz des Cliffhangers noch überlegen.
Stefan Ahnhem: Minus 18°. Ullstein 2017
www.ullsteinbuchverlage.de

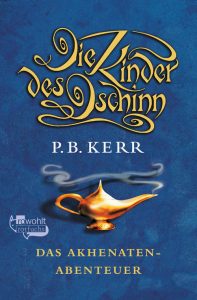 Viele kennen den Briten Philip B. Kerr eher aus dem Krimi- und Thriller-Genre, aber mit der Kinder- und Jugendbuchreihe Die Kinder des Dschinn hat er sich erfolgreich in den Fantasy-Bereich geschrieben.
Viele kennen den Briten Philip B. Kerr eher aus dem Krimi- und Thriller-Genre, aber mit der Kinder- und Jugendbuchreihe Die Kinder des Dschinn hat er sich erfolgreich in den Fantasy-Bereich geschrieben.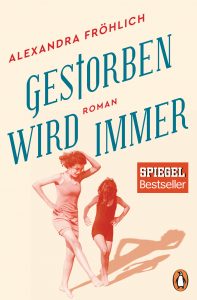
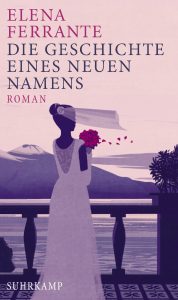 Das Cover lässt keinen Zweifel am Verlauf der Ehe, die Raffaella Cerullo, genannt Lina oder Lila, zu Ende des ersten Bandes Meine geniale Freundin der Neapolitanischen Tetralogie von Elena Ferrante eingegangen ist. Der Brautschleier steht horizontal vom Kopf ab, der Wind reißt die Blütenblätter aus dem Brautstrauß.
Das Cover lässt keinen Zweifel am Verlauf der Ehe, die Raffaella Cerullo, genannt Lina oder Lila, zu Ende des ersten Bandes Meine geniale Freundin der Neapolitanischen Tetralogie von Elena Ferrante eingegangen ist. Der Brautschleier steht horizontal vom Kopf ab, der Wind reißt die Blütenblätter aus dem Brautstrauß.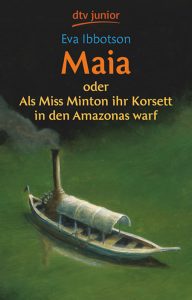 Eine faszinierende Abenteuerreise von London in den Amazonas erlebt die aufgeweckte Waise Maia zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aus Manaus melden sich plötzlich Verwandte von ihr in dem Londoner Internat, wo die ca. 13-Jährige recht zufrieden lebt, auch wenn der Schmerz über den Verlust der Eltern sie bedrückt. Das Ehepaar Carter und seine Zwillinge möchten Maia bei sich aufnehmen. Neugierig auf das Land und die ihr unbekannten Verwandten bricht Maia zusammen mit ihrer Gouvernante Miss Minton nach Manaus auf und erfährt zunächst eine riesengroße Enttäuschung. Die Carters leben völlig abgekapselt von ihrer Umgebung, haben keinerlei Sinn für das Land und interessieren sich lediglich für Maias Vermögen. Doch dann lernt sie Finn kennen, verliebt sich in den Amazonas und lernt allmählich, den Schmerz über den Tod ihrer Eltern zu überwinden. Sogar die strenge Miss Minton kann schließlich in der Farbenpracht und Exotik des Regenwalds ihre strenge viktorianische Haltung hinter sich lassen und wirft ihr Korsett über Bord, besteht allerdings weiterhin auf dem Mathematikunterricht und dem Zähneputzen.
Eine faszinierende Abenteuerreise von London in den Amazonas erlebt die aufgeweckte Waise Maia zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aus Manaus melden sich plötzlich Verwandte von ihr in dem Londoner Internat, wo die ca. 13-Jährige recht zufrieden lebt, auch wenn der Schmerz über den Verlust der Eltern sie bedrückt. Das Ehepaar Carter und seine Zwillinge möchten Maia bei sich aufnehmen. Neugierig auf das Land und die ihr unbekannten Verwandten bricht Maia zusammen mit ihrer Gouvernante Miss Minton nach Manaus auf und erfährt zunächst eine riesengroße Enttäuschung. Die Carters leben völlig abgekapselt von ihrer Umgebung, haben keinerlei Sinn für das Land und interessieren sich lediglich für Maias Vermögen. Doch dann lernt sie Finn kennen, verliebt sich in den Amazonas und lernt allmählich, den Schmerz über den Tod ihrer Eltern zu überwinden. Sogar die strenge Miss Minton kann schließlich in der Farbenpracht und Exotik des Regenwalds ihre strenge viktorianische Haltung hinter sich lassen und wirft ihr Korsett über Bord, besteht allerdings weiterhin auf dem Mathematikunterricht und dem Zähneputzen.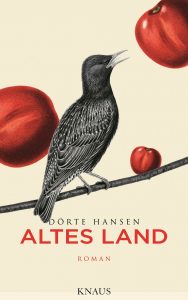
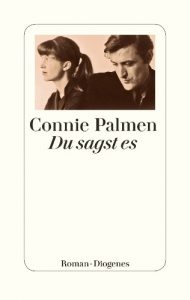 Sie waren eines der berühmtesten Paare des Literaturbetriebs, die amerikanische Dichterin Sylvia Plath (1932 – 1963) und der englische Dichter Ted Hughes (1930 – 1998). Während ihres siebenjährigen Miteinanders galt das Mitgefühl ihrer Umgebung eher ihm, denn Sylvia Plath litt seit ihrer Jugend unter einer bipolaren Störung mit schweren Depressionen und Stimmungsschwankungen, Angstattacken, Alpträumen, dem ambivalenten Verhältnis zu ihrer Mutter und der unbewältigten Trauer um den früh verstorbenen Vater sowie unter ihrem Perfektionismus und übersteigerten Ehrgeiz. 1953 unternahm sie einen ersten Selbstmordversuch und verbrachte anschließend mehrere Monate in einer psychiatrischen Klinik. Ab Ende 1958 war sie erneut in psychiatrischer Behandlung.
Sie waren eines der berühmtesten Paare des Literaturbetriebs, die amerikanische Dichterin Sylvia Plath (1932 – 1963) und der englische Dichter Ted Hughes (1930 – 1998). Während ihres siebenjährigen Miteinanders galt das Mitgefühl ihrer Umgebung eher ihm, denn Sylvia Plath litt seit ihrer Jugend unter einer bipolaren Störung mit schweren Depressionen und Stimmungsschwankungen, Angstattacken, Alpträumen, dem ambivalenten Verhältnis zu ihrer Mutter und der unbewältigten Trauer um den früh verstorbenen Vater sowie unter ihrem Perfektionismus und übersteigerten Ehrgeiz. 1953 unternahm sie einen ersten Selbstmordversuch und verbrachte anschließend mehrere Monate in einer psychiatrischen Klinik. Ab Ende 1958 war sie erneut in psychiatrischer Behandlung.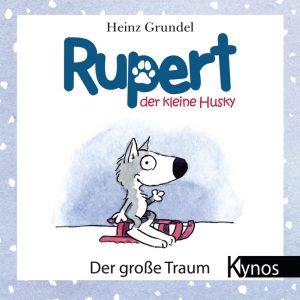 Rupert, der kleine Husky aus Alaska, träumt davon, ein berühmter Schlittenhund zu werden. Zum Glück schenkt Waldi, der Trapper, ihm einen alten Rennschlitten vom berühmten Rennen von Nome, den Rupert sofort auf Vordermann bringt und rot lackiert.
Rupert, der kleine Husky aus Alaska, träumt davon, ein berühmter Schlittenhund zu werden. Zum Glück schenkt Waldi, der Trapper, ihm einen alten Rennschlitten vom berühmten Rennen von Nome, den Rupert sofort auf Vordermann bringt und rot lackiert.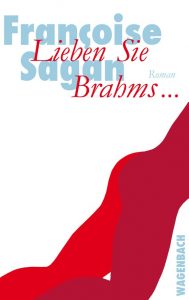 Françoise Sagan (1935 – 2004) war zeitweise Frankreichs erfolgreichste Bestsellerautorin. In meiner Jugend habe ich Bonjour tristesse verschlungen und geliebt, heute liegt mir Lieben Sie Brahms, ihr Roman aus dem Jahr 1959, näher, mit dem ich vor 30 Jahren eher weniger anfangen konnte. Alles eben eine Frage des Alters.
Françoise Sagan (1935 – 2004) war zeitweise Frankreichs erfolgreichste Bestsellerautorin. In meiner Jugend habe ich Bonjour tristesse verschlungen und geliebt, heute liegt mir Lieben Sie Brahms, ihr Roman aus dem Jahr 1959, näher, mit dem ich vor 30 Jahren eher weniger anfangen konnte. Alles eben eine Frage des Alters.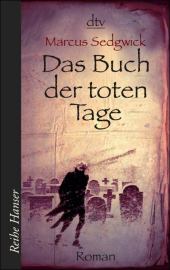 In die Zeit zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, passt dieses Buch, denn es sind die „toten Tage“.
In die Zeit zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, passt dieses Buch, denn es sind die „toten Tage“.