![]() 22 Sachgeschichten für wissbegierige Kinder ab fünf Jahren
22 Sachgeschichten für wissbegierige Kinder ab fünf Jahren
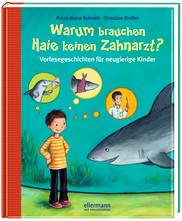 Kinderfragen sind berüchtigt und nicht selten blamieren wir Erwachsenen uns beim spontanen Antwortversuch. Auch bei den 22 Kinderfragen in diesem Sachbuch hätte ich teilweise keine allzu gute Figur abgegeben, und selbst wenn ich sie hätte beantworten können, dann bestimmt nicht so unterhaltsam und kindgerecht wie Petra Maria Schmitt und Christian Dreller. Die beiden Autoren kombinieren die Sachinformationen mit Rahmengeschichten, die die Fragen logisch entwickeln und in eine Alltagssituation aus der Erlebniswelt der Kinder einbetten.
Kinderfragen sind berüchtigt und nicht selten blamieren wir Erwachsenen uns beim spontanen Antwortversuch. Auch bei den 22 Kinderfragen in diesem Sachbuch hätte ich teilweise keine allzu gute Figur abgegeben, und selbst wenn ich sie hätte beantworten können, dann bestimmt nicht so unterhaltsam und kindgerecht wie Petra Maria Schmitt und Christian Dreller. Die beiden Autoren kombinieren die Sachinformationen mit Rahmengeschichten, die die Fragen logisch entwickeln und in eine Alltagssituation aus der Erlebniswelt der Kinder einbetten.
Anworten gibt es in diesem Band auf folgende Fragen:
- Warum brauchen Haie keinen Zahnarzt?
- Kann man im Hanstand essen und trinken?
- Können sich Pflanzen unterhalten?
- Warum bekommen Pinguine keine kalten Füße?
- Warum haben Indianer keinen Bart?
- Warum fallen Vögel beim Schlafen nicht vom Baum?
- Wieso sehen Fledermäuse mit den Ohren?
- Warum knurrt manchmal unser Magen?
- Warum gibt es so viele Sprachen?
- Warum heben Hunde beim Pipimachen ihr Bein?
- Brauchen Eskimos Kühlschränke?
- Warum haben Giraffen so einen langen Hals?
- Warum können Schiffe schwimmen?
- Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta?
- Warum bekommen wir einen Schluckauf?
- Ist das Faultier wirklich faul?
- Wie entstehen Blitz und Donner?
- Warum spucken Vulkane Feuer?
- Warum haben Kamele einen Höcker?
- Warum haben Omas und Opas weiße Haare?
- Warum ist das Meer blau?
- Warum muss man weinen, wenn man traurig ist?
Jede Geschichte umfasst vier bis sieben Seiten und vermittelt spielerisch Wissen, ohne dabei belehrend zu wirken. Die bunten Bilder von Heike Vogel illustrieren altersgerecht sowohl die Rahmenhandlungen als auch die Sachinformationen.
Warum brauchen Haie keinen Zahnarzt ist ganau das richtige Vorlesebuch für neugierige Vorschulkinder und vor allem für Grundschülerinnen und Grundschüler, die das Buch ab der vierten Klasse auch selbst lesen können. Nicht nur sie alle werden Überraschendes erfahren, auch die Erwachsenen können in diesem hochwertig hergestellten, preisgünstigen Kindersachbuch unterhaltsam dazulernen.
Petra Maria Schmitt & Christian Dreller: Warum brauchen Haie keinen Zahnarzt? Ellermann 2016
www.ellermann.de

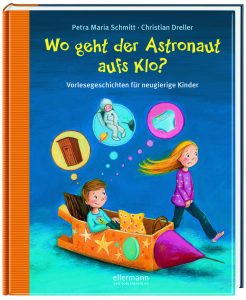 Kinderfragen sind berüchtigt und nicht selten blamieren wir Erwachsenen uns beim spontanen Antwortversuch. Auch bei den 22 Kinderfragen in diesem Sachbuch hätte ich teilweise keine allzu gute Figur abgegeben, und selbst wenn ich sie hätte beantworten können, dann bestimmt nicht so unterhaltsam und kindgerecht wie Petra Maria Schmitt und Christian Dreller. Die beiden Autoren kombinieren die Sachinformationen mit Rahmengeschichten, die die Fragen logisch entwickeln und in eine Alltagssituation aus der Erlebniswelt der Kinder einbetten.
Kinderfragen sind berüchtigt und nicht selten blamieren wir Erwachsenen uns beim spontanen Antwortversuch. Auch bei den 22 Kinderfragen in diesem Sachbuch hätte ich teilweise keine allzu gute Figur abgegeben, und selbst wenn ich sie hätte beantworten können, dann bestimmt nicht so unterhaltsam und kindgerecht wie Petra Maria Schmitt und Christian Dreller. Die beiden Autoren kombinieren die Sachinformationen mit Rahmengeschichten, die die Fragen logisch entwickeln und in eine Alltagssituation aus der Erlebniswelt der Kinder einbetten.
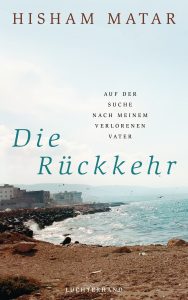
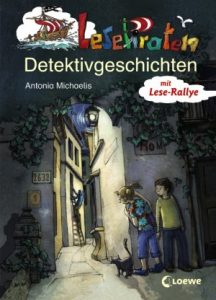 Die Detektivgeschichten von Antonia Michaelis stammen aus der Zeit, als die Erstlesereihe des Loewe Verlags noch vier Stufen umfasste. Die Lesepiraten, zu denen dieser Band gehört, waren die dritte Lesestufe und richtete sich an fortgeschrittene Leserinnen und Leser ab ca. sieben Jahren.
Die Detektivgeschichten von Antonia Michaelis stammen aus der Zeit, als die Erstlesereihe des Loewe Verlags noch vier Stufen umfasste. Die Lesepiraten, zu denen dieser Band gehört, waren die dritte Lesestufe und richtete sich an fortgeschrittene Leserinnen und Leser ab ca. sieben Jahren.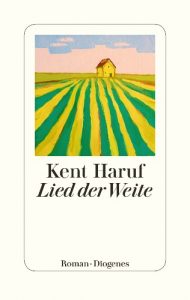 Lied der Weite, im Original 1999 erschienen unter dem Titel Plainsong, ist der dritte von sechs Romanen des US-Amerikaners Kent Haruf (1943 – 2014). Da ich 2017 seinen letzten, Unsere Seelen bei Nacht, gelesen und sehr geliebt habe, waren meine Erwartungen hoch – und wurden erfüllt. Noch mehr als die Handlung haben mich die Charaktere und die Atmosphäre bezaubert. Die unaufgeregte Erzählweise, das genaue Beobachten, das bedächtige Erzähltempo und die atmosphärische Schilderung des Lebens in der fiktiven Kleinstadt Holt, Colorado, in der alle Romane Harufs angesiedelt sind, machen auch dieses Buch für mich zu einem literarischen Kleinod.
Lied der Weite, im Original 1999 erschienen unter dem Titel Plainsong, ist der dritte von sechs Romanen des US-Amerikaners Kent Haruf (1943 – 2014). Da ich 2017 seinen letzten, Unsere Seelen bei Nacht, gelesen und sehr geliebt habe, waren meine Erwartungen hoch – und wurden erfüllt. Noch mehr als die Handlung haben mich die Charaktere und die Atmosphäre bezaubert. Die unaufgeregte Erzählweise, das genaue Beobachten, das bedächtige Erzähltempo und die atmosphärische Schilderung des Lebens in der fiktiven Kleinstadt Holt, Colorado, in der alle Romane Harufs angesiedelt sind, machen auch dieses Buch für mich zu einem literarischen Kleinod.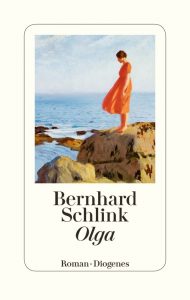 Viel Stoff hat Bernhard Schlink in diesen Roman gepackt: einen Parforceritt durch die deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis 1971, Reisen in ferne Länder, eine unvollendete Liebesgeschichte und die Lebensgeschichte einer beeindruckenden Frau.
Viel Stoff hat Bernhard Schlink in diesen Roman gepackt: einen Parforceritt durch die deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis 1971, Reisen in ferne Länder, eine unvollendete Liebesgeschichte und die Lebensgeschichte einer beeindruckenden Frau.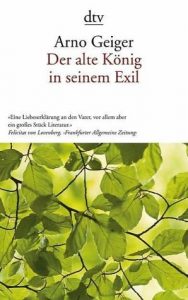 „Man muss auch das Allgemeinste persönlich darstellen“, ein Zitat des japanischen Malers Katsushika Hokusai (1760 – 1849), stellt Arno Geiger dem Buch über das Leben und die Demenzerkrankung seines Vaters voran. Die Umsetzung dieses Mottos ist dem österreichischen Autor gelungen, die Krankheit erhält durch das Schicksal des Vaters August Geiger ein Gesicht. Aber nicht nur das: Arno Geiger dokumentiert ein über 80 Jahre währendes Leben, würdigt, was er seit der Entfremdung vom Vater während der Pubertät nicht mehr wertschätzte, und beschreibt den Strukturwandel in der Vorarlberger Heimat von der bäuerlichen Dorfwelt zur Wohn- und Industriegemeinde.
„Man muss auch das Allgemeinste persönlich darstellen“, ein Zitat des japanischen Malers Katsushika Hokusai (1760 – 1849), stellt Arno Geiger dem Buch über das Leben und die Demenzerkrankung seines Vaters voran. Die Umsetzung dieses Mottos ist dem österreichischen Autor gelungen, die Krankheit erhält durch das Schicksal des Vaters August Geiger ein Gesicht. Aber nicht nur das: Arno Geiger dokumentiert ein über 80 Jahre währendes Leben, würdigt, was er seit der Entfremdung vom Vater während der Pubertät nicht mehr wertschätzte, und beschreibt den Strukturwandel in der Vorarlberger Heimat von der bäuerlichen Dorfwelt zur Wohn- und Industriegemeinde. Das hätte es unter den strengen Augen von Mr Carson, Butler auf Downton Abbey, nicht gegeben: ein sieben Jahre währendes Verhältnis zwischen einem jungen Dienstmädchen und dem Erben des Nachbarguts. Doch erstens sind wir bei Ein Festtag, dem Roman oder besser der Novelle von Graham Swift, in der Grafschaft Berkshire und nicht in Yorkshire, und zweitens sind nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die Regeln der englischen Klassengesellschaft tief erschüttert. Auf drei benachbarten Gütern sind die meisten Söhne im Krieg geblieben und das Personal in Upleigh bzw. Beechwood House ist auf je eine Köchin und ein Dienstmädchen zusammengeschrumpft. So kann das Dienstmädchen Jane Fairchild von Beechwood, wo Mr und Mrs Niven seit dem Tod ihrer Söhne alleine leben, sich jahrelang heimlich mit dem einzig verbliebenen Erben von Upleigh, Paul Sheringham, an verschwiegenen Orten treffen, zunächst für Geld, doch als es „ernst“ wird nur noch als Freundin und Geliebte.
Das hätte es unter den strengen Augen von Mr Carson, Butler auf Downton Abbey, nicht gegeben: ein sieben Jahre währendes Verhältnis zwischen einem jungen Dienstmädchen und dem Erben des Nachbarguts. Doch erstens sind wir bei Ein Festtag, dem Roman oder besser der Novelle von Graham Swift, in der Grafschaft Berkshire und nicht in Yorkshire, und zweitens sind nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die Regeln der englischen Klassengesellschaft tief erschüttert. Auf drei benachbarten Gütern sind die meisten Söhne im Krieg geblieben und das Personal in Upleigh bzw. Beechwood House ist auf je eine Köchin und ein Dienstmädchen zusammengeschrumpft. So kann das Dienstmädchen Jane Fairchild von Beechwood, wo Mr und Mrs Niven seit dem Tod ihrer Söhne alleine leben, sich jahrelang heimlich mit dem einzig verbliebenen Erben von Upleigh, Paul Sheringham, an verschwiegenen Orten treffen, zunächst für Geld, doch als es „ernst“ wird nur noch als Freundin und Geliebte.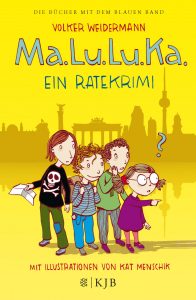 Wenn bekannte Autoren aus dem Erwachsenenbereich ein Kinderbuch schreiben, ist das ein spannendes Experiment, das grundsätzlich meine Neugier weckt. Im Falle von Ma.Lu.Lu.Ka., einem Kinderratekrimi von Volker Weidermann, konnte mich das Resultat allerdings leider überhaupt nicht überzeugen.
Wenn bekannte Autoren aus dem Erwachsenenbereich ein Kinderbuch schreiben, ist das ein spannendes Experiment, das grundsätzlich meine Neugier weckt. Im Falle von Ma.Lu.Lu.Ka., einem Kinderratekrimi von Volker Weidermann, konnte mich das Resultat allerdings leider überhaupt nicht überzeugen.