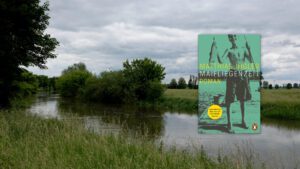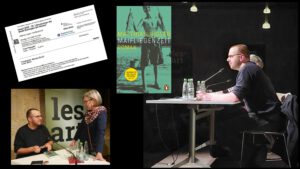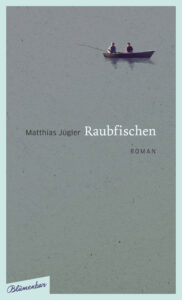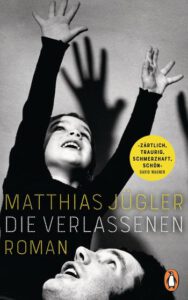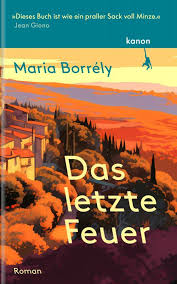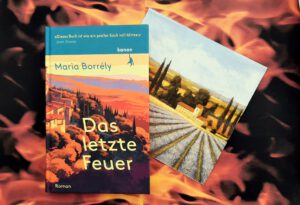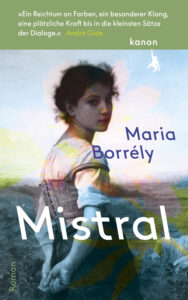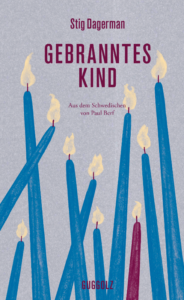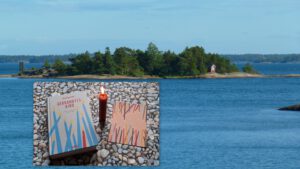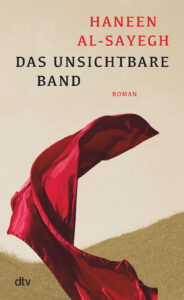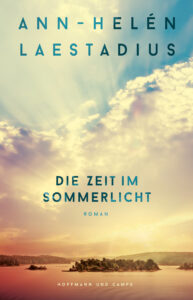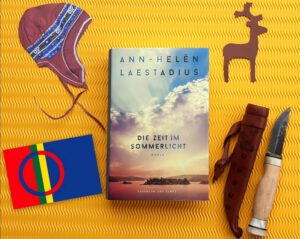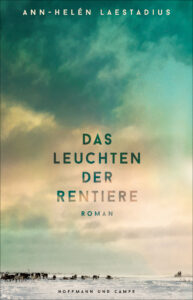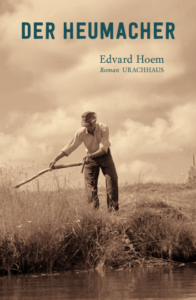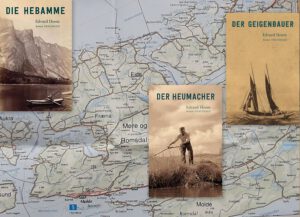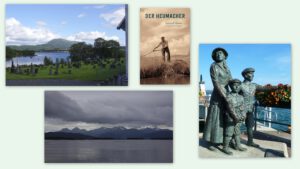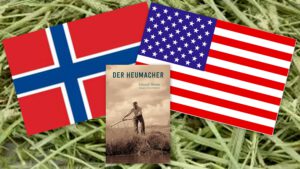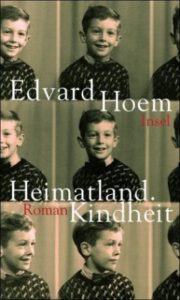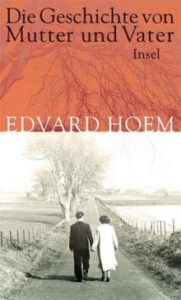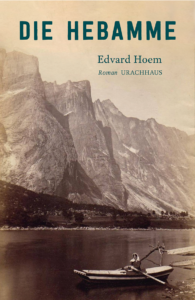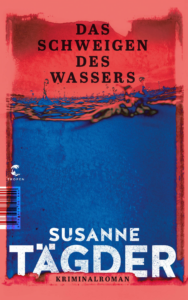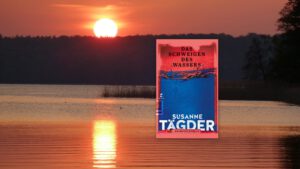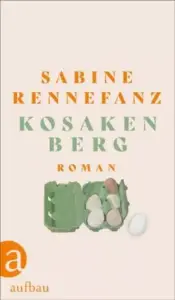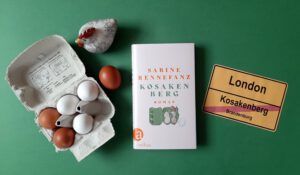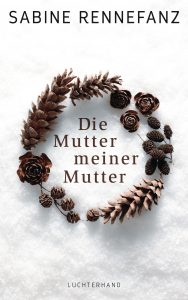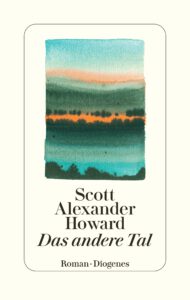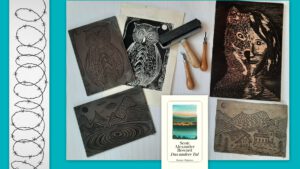Aus Tragödien lernen
Aus Tragödien lernen
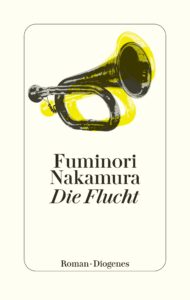
Gleich zwei Protagonisten hat der knapp 600 Seiten starke Roman Die Flucht des 1977 geborenen Japaners Fuminori Nakamura, der aufgrund seiner zahlreichen Auszeichnungen längst mehr als nur Nachwuchshoffnung ist: den Ich-Erzähler Kenji Yamamine und eine sagenumwobene Trompete, genannt „Fanaticism“. Das legendäre Instrument hält die durch eine riesige Themenvielfalt geprägte Handlung zusammen. Als es dem knapp 40-jährigen Investigativjournalisten und Buchautor Kenji auf den Philippinen in die Hände fällt, bringt es fortan sein Leben gehörig durcheinander und in höchste Gefahr, denn unterschiedlichste Interessengruppen wollen es aus verschiedenen Motiven in ihren Besitz bringen. Die Trompete und ihr ehemaliger Besitzer Suzuki sollen Unglaubliches vollbracht haben: Als ihre magischen Töne während einer Schlacht im Zweiten Weltkrieg erklangen, wendete sich eine aussichtslose Militäroperation der Japaner gegen die Amerikaner auf den Philippinen zum Sieg.
Ein weiter Bogen
Während Kenji im Stile eines Mystery-Thrillers um die halbe Welt gejagt wird – der Roman beginnt mit einem Überfall auf ihn in Köln durch den geheimnisvollen B., laut Nachwort des Autors „eine Figur zwischen Realität und Fiktion“ (S. 581) und stets nass, von Hundegebell begleitet und nach Eau de Cologne riechend – tauchen wir in lange Passagen im Stil eines erzählenden Sachbuchs über die Geschichte Japans und verschiedener Nachbarstaaten ein. Dabei geht es beispielsweise um die unvorstellbar brutalen, detailliert beschriebenen Christenverfolgungen ab ca. 1600, hauptsächlich in der Gegend um Nagasaki, die erst mit den Handelsbeziehungen zum Westen Ende des 19. Jahrhunderts endeten, ein Beispiel dafür, dass das in Verruf geratene „Wandel durch Handel“ doch gelingen kann. Von hier schlägt Fuminori Nakamura den Bogen zu Japans Gewaltverbrechen im Zweiten Weltkrieg, zum Atombombenabwurf auf Nagasaki, zur Atomkatastrophe von Fukuschima, deutschen Konzentrationslagern und zur Geschichte verschiedener Nachbarstaaten – ein überwältigendes Themen-Potpourri, das hier nur angerissen werden kann.

Als links-progressiver Journalist und Autor des umstrittenen Buches „Menschen, die am Krieg verdienen“ kämpft Kenji gegen Japans zunehmenden Rechtsruck und nationalistische, demokratiefeindliche Kräfte. Die Trompete als Symbol für eine militaristische Weltanschauung ist ihm daher zunächst suspekt. Trotzdem ist er bei ihrem Anblick sofort gebannt, verfasst einen Artikel über sie und gerät ins Fadenkreuz verschiedenster Interessengruppen.
Nicht nur die Trompete findet Kenji auf den Philippinen, er begegnet auch der Vietnamesin Anh Thi Nguyên, die ihm nach Japan, ins Land ihrer Urahnin, folgt. Die Liebe bleibt ohne Happy End, das gemeinsame Buchprojekt schrumpft zu einem Roman mit dem Titel „Eine Seite der Geschichte“.
Ein schwerer, aber lohnender Brocken
Die Flucht, in Japan 2020 als Buch und zuvor als Fortsetzungsroman in bedeutenden Zeitungen erschienen, will keine Wohlfühllektüre sein, wie der Autor im Nachwort betont:
Und auch ich bin der Auffassung, dass sich die Welt nicht bessern kann und die Menschheitsgeschichte immer neue Tragödien hervorbringen wird, wenn es nur Geschichten gibt, die den Gerechte-Welt-Glauben bestärken (und uns damit unterbewusst beeinflussen). (S. 582)
Entsprechend erweist sich die äußerst verstrickte, komplexe Mischung aus historischem Roman, Action-Thriller, Liebesgeschichte und brandaktuellem Beitrag zum Zeitgeschehen als schwerer Brocken, der aufgrund seiner Gewaltbeschreibungen starke Nerven erfordert. Nimmt man die Mühen allerdings auf sich, erschließt sich in den umfangreichen historisch-politischen Teilen, die mir als Nicht-Thriller-Leserin wesentlich wichtiger waren, eine ganze, wenn auch meist düstere Welt.
Fuminori Nakamura: Die Flucht. Aus dem Japanischen von Luise Steggewentz. Diogenes 2024
www.diogenes.ch