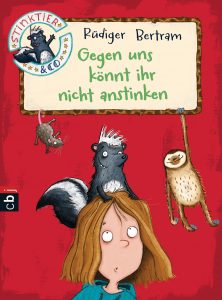![]() School is cool – English is cool!
School is cool – English is cool!
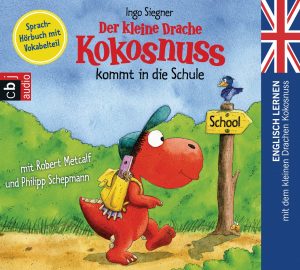
Nicht jedes Produkt, das sich der Kinderbuchlieblinge bedient, bekommt meine Zustimmung, aber eine CD zum Englischlernen mit dem kleinen Drachen Kokosnuss finde ich eine sehr gute Idee. Philipp Schepmann und dem Native Speaker Robert Metcalf hört man gerne zu und für den ein oder anderen Lacher sind die liebevoll erzählten Geschichten um den sympathischen Kokosnuss immer gut.
Es ist der erste Schultag für Kokosnuss und alles ist natürlich sehr aufregend. Dass Robert Robertson von den britischen Inseln kommt und die Klasse beim Englischunterricht unterstützen soll, ist noch viel aufregender. Und so lernt Kokosnuss in seinen ersten Tagen in der Schulhöhle nicht nur das Alphabet und die Zahlen auf Englisch, er lernt auch Schwimmen und darf mit seiner Klasse einen spannenden Ausflug zu einer alten Schildkröte auf ihrer Insel machen. Oskar, der kleine Fressdrache, hat es dagegen nicht so gut: Seine Eltern erlauben den Schulbesuch zunächst nicht, denn wozu sollte das gut sein? Schließlich wird dann aber doch noch alles gut…
Die CD macht einerseits Lust auf Schule und vermittelt andererseits erste englische Vokabeln und kurze Sätze in gesprochener und gesungener Form. Am Ende bleibt bestimmt das ein oder andere Wort hängen und die Neugier auf die Sprache kann mit dieser CD schon ab dem Vorschulalter geweckt werden.
Ingo Siegner: Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule. cbj audio 2016
www.randomhouse.de

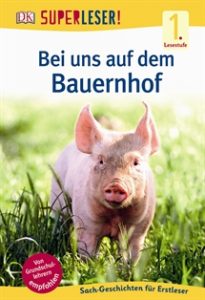 Sachgeschichten für Erstleser gibt es bei Dorling Kindersley in der Reihe Superleser! und der vorliegende Band Bei uns auf dem Bauernhof gehört zur ersten Lesestufe und richtet sich an Leseanfänger ab der ersten Klasse. Entsprechend sind die Zeilen und Sätze kurz und im Flattersatz gesetzt, die Seiten klar gegliedert und reich bebildert, die Wörter sind meist einfach und die Fibelschrift ist extragroß. Der Preis ist mit 5,95 EUR für ein gebundenes Erstleserbuch niedrig, zumal das Buch sogar über ein Lesebändchen verfügt.
Sachgeschichten für Erstleser gibt es bei Dorling Kindersley in der Reihe Superleser! und der vorliegende Band Bei uns auf dem Bauernhof gehört zur ersten Lesestufe und richtet sich an Leseanfänger ab der ersten Klasse. Entsprechend sind die Zeilen und Sätze kurz und im Flattersatz gesetzt, die Seiten klar gegliedert und reich bebildert, die Wörter sind meist einfach und die Fibelschrift ist extragroß. Der Preis ist mit 5,95 EUR für ein gebundenes Erstleserbuch niedrig, zumal das Buch sogar über ein Lesebändchen verfügt.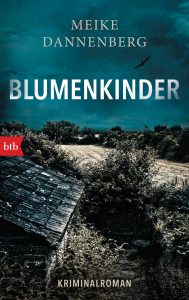
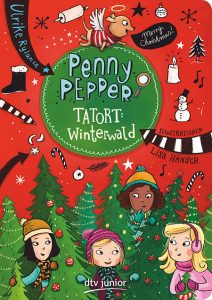 „Bei allen sieben Winden, den Schuft werden wir finden“ ist das Motto von Penny Pepper und Ida, Marie und Flora. Im vierten Band der Reihe um die aufgeweckte Ich-Erzählerin Penny und ihre Detektiv-Freundinnen geht es in der Adventszeit ziemlich turbulent zu. Da muss geklärt werden, wohin die Schokolade aus dem Schul-Adventskalender verschwindet und vor allem, warum es keine Weihnachtsbäume gibt: In Buckendorf sind sie verschwunden, in Muckendorf wurden aus Versehen Krüppelkiefern gepflanzt, in Kluckendorf sind alle abgebrannt, auf dem Weihnachtsmarkt kommt die Lieferung der Spedition nicht an und die Bäume von Maries Opa scheinen an einer seltsamen Krankheit zu leiden. Nachdem auch noch bereits gekaufte Bäume von Balkonen verschwinden, glauben die cleveren Detektivinnen nicht mehr an einen Zufall und die Ermittlungen können beginnen… Vor lauter Aufregung kommt Penny kaum noch dazu, sich über die seltsamen Überraschungen in ihrem Adventskalender zu wundern, einen kleinen Ball, ungenießbare Lebkuchen, ein Mini-Frisbee, Kauknochen, ein quietschendes Gummihuhn, eine Bürste und ähnliche scheinbar nutzlose Dinge.
„Bei allen sieben Winden, den Schuft werden wir finden“ ist das Motto von Penny Pepper und Ida, Marie und Flora. Im vierten Band der Reihe um die aufgeweckte Ich-Erzählerin Penny und ihre Detektiv-Freundinnen geht es in der Adventszeit ziemlich turbulent zu. Da muss geklärt werden, wohin die Schokolade aus dem Schul-Adventskalender verschwindet und vor allem, warum es keine Weihnachtsbäume gibt: In Buckendorf sind sie verschwunden, in Muckendorf wurden aus Versehen Krüppelkiefern gepflanzt, in Kluckendorf sind alle abgebrannt, auf dem Weihnachtsmarkt kommt die Lieferung der Spedition nicht an und die Bäume von Maries Opa scheinen an einer seltsamen Krankheit zu leiden. Nachdem auch noch bereits gekaufte Bäume von Balkonen verschwinden, glauben die cleveren Detektivinnen nicht mehr an einen Zufall und die Ermittlungen können beginnen… Vor lauter Aufregung kommt Penny kaum noch dazu, sich über die seltsamen Überraschungen in ihrem Adventskalender zu wundern, einen kleinen Ball, ungenießbare Lebkuchen, ein Mini-Frisbee, Kauknochen, ein quietschendes Gummihuhn, eine Bürste und ähnliche scheinbar nutzlose Dinge.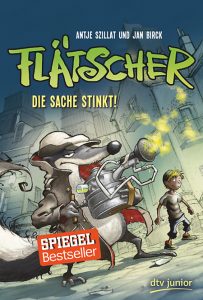 Unter mangelndem Selbstbewusstsein leidet er nun wirklich nicht, Flätscher, der bestimmt kein Marder und noch bestimmter keine Ratte, keine Katze und auch kein Hund ist, sondern das cleverste Stinktier der Großstadt und des Universums. Mit Theo, dem Sohn seines Lieblings-Semmelknödelkochs Bode, eröffnet er eine Hinterhof-Detektei, und kaum ist die Sekretärinnenstelle mit der charmanten rosaroten Wieseldame Cloe besetzt, bei der Flätscher „glühend-teuflisch-hitzig-schwitzig-kochend-heiß“ wird und „seine Beine sich wie Vanillepudding anfühlen“, schneit auch schon der erste Fall ins Haus: Meisterkoch Bode, Theos Vater, wird wiederholt von einem miesen „Rechnungsnichtbezahler“ heimgesucht, der sein Sternerestaurant Wilder Elch zu ruinieren droht. Mit vereinten Kräften und viel Köpfchen ermitteln Meisterdetektiv Flätscher und Assistent Theo im Milieu der Spitzengastronomie.
Unter mangelndem Selbstbewusstsein leidet er nun wirklich nicht, Flätscher, der bestimmt kein Marder und noch bestimmter keine Ratte, keine Katze und auch kein Hund ist, sondern das cleverste Stinktier der Großstadt und des Universums. Mit Theo, dem Sohn seines Lieblings-Semmelknödelkochs Bode, eröffnet er eine Hinterhof-Detektei, und kaum ist die Sekretärinnenstelle mit der charmanten rosaroten Wieseldame Cloe besetzt, bei der Flätscher „glühend-teuflisch-hitzig-schwitzig-kochend-heiß“ wird und „seine Beine sich wie Vanillepudding anfühlen“, schneit auch schon der erste Fall ins Haus: Meisterkoch Bode, Theos Vater, wird wiederholt von einem miesen „Rechnungsnichtbezahler“ heimgesucht, der sein Sternerestaurant Wilder Elch zu ruinieren droht. Mit vereinten Kräften und viel Köpfchen ermitteln Meisterdetektiv Flätscher und Assistent Theo im Milieu der Spitzengastronomie.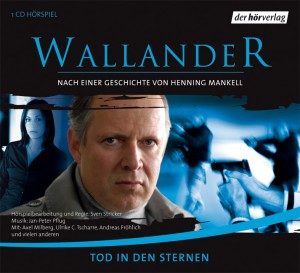 Ich liebe die Wallander-Krimis von Henning Mankell und Axel Milberg verkörpert den eigenbrötlerischen Kommissar stimmlich genau so, wie ich ihn mir beim Lesen der Bücher vorstelle.
Ich liebe die Wallander-Krimis von Henning Mankell und Axel Milberg verkörpert den eigenbrötlerischen Kommissar stimmlich genau so, wie ich ihn mir beim Lesen der Bücher vorstelle.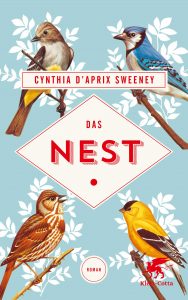 Der Vater, Leonard Plumb, hat es gut mit Melody, Beatrice, Jack und Leo gemeint. Der Fond mit ihrem Erbe, von ihnen „das Nest“ genannt, soll am 40. Geburtstag der Jüngsten in der Geschwisterreihe, Melody, ausbezahlt werden. Darauf haben sie sich immer voll und ganz verlassen: Melody, die ganz in ihrer Rolle als Helikoptermutter aufgeht und für ihre Töchter nur das allerbeste bzw. die Erfüllung ihrer eigenen Träume möchte, Bea, die nach einem Erfolg als Schriftstellerin in jungen Jahren nie mehr etwas zustande gebracht hat, Jack, ein erfolgloser Antiquitätenhändler, der ein ewiges Kind geblieben ist und immer mehr vom Leben verlangt, als er bereit zu leisten ist, und Leo, der unsympathische Playboy, der sehr jung in der Medienbrache reich geworden ist und sein ganzes Geld durchgebracht hat. Eben dieser durch und durch egozentrische Älteste ist es, der mit Hilfe seiner unfähigen Mutter den Fond plündert, nachdem er wieder einmal Mist gebaut hat. Schlagartig stehen Melody, Bea und Jack vor dem Nichts und sind zum ersten Mal gezwungen, ihr Leben ohne die Aussicht auf die Erbschaft auf die Reihe zu bekommen.
Der Vater, Leonard Plumb, hat es gut mit Melody, Beatrice, Jack und Leo gemeint. Der Fond mit ihrem Erbe, von ihnen „das Nest“ genannt, soll am 40. Geburtstag der Jüngsten in der Geschwisterreihe, Melody, ausbezahlt werden. Darauf haben sie sich immer voll und ganz verlassen: Melody, die ganz in ihrer Rolle als Helikoptermutter aufgeht und für ihre Töchter nur das allerbeste bzw. die Erfüllung ihrer eigenen Träume möchte, Bea, die nach einem Erfolg als Schriftstellerin in jungen Jahren nie mehr etwas zustande gebracht hat, Jack, ein erfolgloser Antiquitätenhändler, der ein ewiges Kind geblieben ist und immer mehr vom Leben verlangt, als er bereit zu leisten ist, und Leo, der unsympathische Playboy, der sehr jung in der Medienbrache reich geworden ist und sein ganzes Geld durchgebracht hat. Eben dieser durch und durch egozentrische Älteste ist es, der mit Hilfe seiner unfähigen Mutter den Fond plündert, nachdem er wieder einmal Mist gebaut hat. Schlagartig stehen Melody, Bea und Jack vor dem Nichts und sind zum ersten Mal gezwungen, ihr Leben ohne die Aussicht auf die Erbschaft auf die Reihe zu bekommen.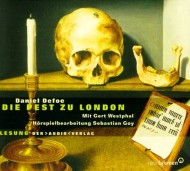 Daniel Defoe (ca. 1660 – 1731), der englische Schriftsteller aus der Zeit der frühen Aufklärung, wurde vor allem durch seinen Roman Das Leben und die seltsamen Abenteuer des Robinson Crusoe bekannt, den er 1719 verfasste.
Daniel Defoe (ca. 1660 – 1731), der englische Schriftsteller aus der Zeit der frühen Aufklärung, wurde vor allem durch seinen Roman Das Leben und die seltsamen Abenteuer des Robinson Crusoe bekannt, den er 1719 verfasste.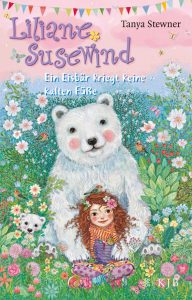 Mit Band elf Ein Eisbär kriegt keine kalten Füße bin ich in die Liliane-Susewind-Reihe eingestiegen, ohne Verständnisprobleme, denn es wird alles Wissenswerte gut erklärt, aber mit einer stetig steigenden Neugier auf die vorherigen Bände durch geschickt eingestreute Andeutungen.
Mit Band elf Ein Eisbär kriegt keine kalten Füße bin ich in die Liliane-Susewind-Reihe eingestiegen, ohne Verständnisprobleme, denn es wird alles Wissenswerte gut erklärt, aber mit einer stetig steigenden Neugier auf die vorherigen Bände durch geschickt eingestreute Andeutungen.