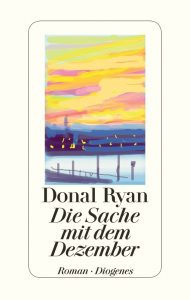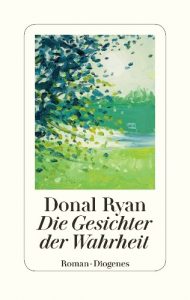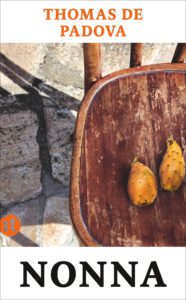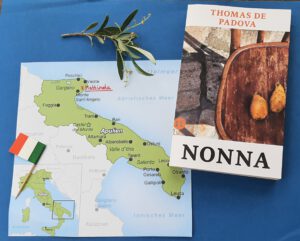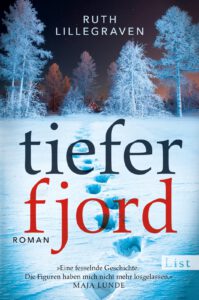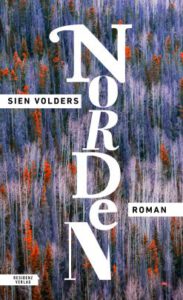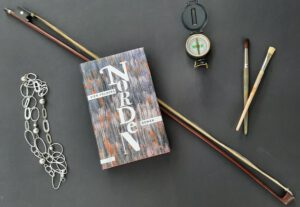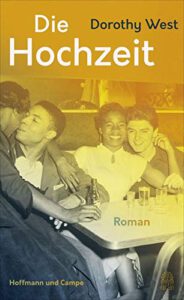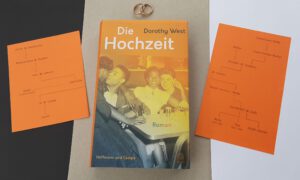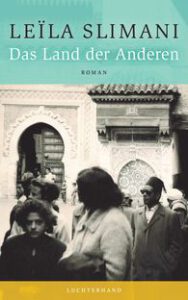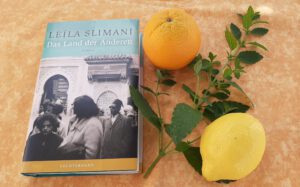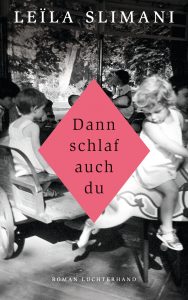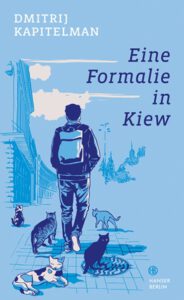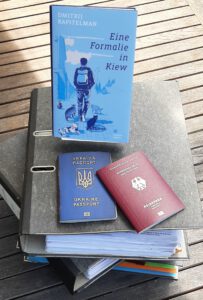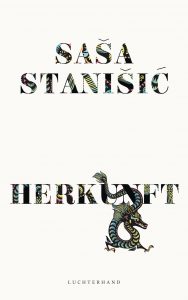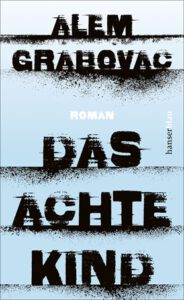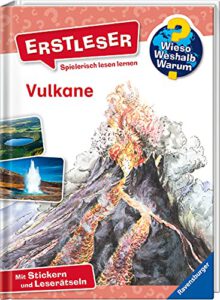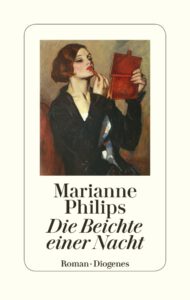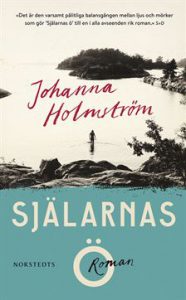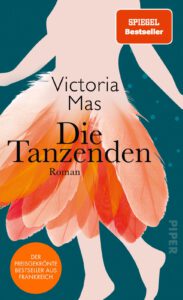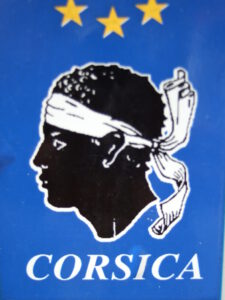Von Bäumen, Inseln und menschlichen Schicksalen
Von Bäumen, Inseln und menschlichen Schicksalen
Ich erzähle dir etwas über Bäume. […] Sie sprechen über unterirdische Gänge miteinander, die Pilze von ihren Wurzeln aus gebahnt haben, sie senden Zelle für Zelle ihre Nachrichten, und das mit einer Geduld, die wohl nur ein Lebewesen aufbringt, das sich nicht vom Fleck rührt. (S. 9)
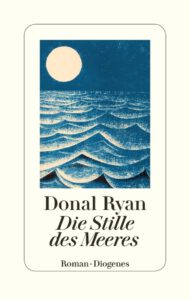
Die ersten Sätze des Romans Die Stille des Meeres bereiten die zentrale Aussage des irischen Autors Donal Ryan vor: Das Ganze besteht aus vermeintlich Unverbundenem, einzelne Bäume ebenso wie einzelne menschliche Schicksale, so weit sie auch auseinanderliegen mögen. Dabei ist die Verbindung oft für das Auge unsichtbar. Im letzten der vier Teile des Buchs mit dem Titel Seeinseln wird der Gedanke noch einmal aufgegriffen und das unterirdische Geflecht für uns ans Tageslicht geholt.
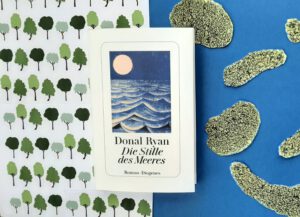
Teil eins bis drei: Drei Leben
Doch bevor die Verbindungen der drei Protagonisten sichtbar werden, ist jedem von ihnen ein eigener Teil des Romans gewidmet, jeweils mit einer eigenen Erzählstimme. Farouk, der syrische Arzt, vertraut im ersten Teil nach dem Eindringen des IS in seine Heimatstadt sein Leben, das seiner christlichen Frau und seiner vergötterten Tochter gewissenlosen Schleusern an. Farouks Geschichte ist mit Abstand am besten gelungen, atemlos, sparsam und poetisch erzählt, tief erschütternd und zu Herzen gehend traurig.
Lampy, ein 23-jähriger Ire, uneheliches Kind eines ihm unbekannten Vaters und dafür gehänselt, lebt bei seiner Mutter und seinem Großvater. Er ist nie richtig erwachsen geworden, lässt sich orientierungslos treiben und jobbt nach einem missglückten Studienversuch als ungelernte Hilfskraft im Altenheim. Liebeskummer, unkontrolliertes Aggressionspotential und tiefe Traurigkeit zerreißen ihn. Er sehnt sich nach einem Neuanfang, wo ihn niemand kennt, und ist doch zu schwach dafür. Der zweite Teil über Lampy ist direkter, in Umgangssprache und teils mit Humor erzählt.
Gänzlich unsympathisch, trotz bemitleidenswerter Kindheit, ist als dritte Hauptfigur der erfolgreiche Chef einer irischen Beraterfirma und durchtriebene Lobbyist John. Er manipuliert und vernichtet Menschen gnadenlos. Obwohl nicht religiös, erfahren wir seinen ungeschönten Lebensbericht in Form einer Beichte aus der Ich-Perspektive. Trotz seines kometenhaften beruflichen Aufstiegs war das private Glück nur einmal kurz zum Greifen nah.
Teil vier: Unterirdische Gänge
Am Ende des dritten Teils war ich ratlos bezüglich des verbindenden Elements zwischen den Protagonisten. War es, dass sie einmal in ihrem Leben den Tod vor Augen hatten? Dass sie alle eine große Liebe verloren und eine unbestimmte Sehnsucht sie antrieb? Dabei hätte ich mich nur an die Bäume vom Beginn erinnern müssen: Auch zwischen Farouk, Lampy und John bestehen unsichtbare Verbindungen, überaus kunstvoll konstruiert, unwahrscheinlich zwar, aber für mich nicht zu unglaubwürdig, wenn man sich die Geschichte rückwärts erzählt vorstellt. Mit dem vierten Teil bekamen nun plötzlich auch vermeintlich unbedeutende, unverständlich ausführlich erzählte Episoden aus den vorhergehenden Abschnitten einen Sinn.
Ein komplexes Buch
Eine lohnende Lektüre also, auch wenn der erste und letzte Teil für mich wesentlich stärker waren als die beiden in der Mitte. Vielleicht lese ich die komplexe Sammlung dieser einzelnen, miteinander verbundenen Geschichten, mit der Donal Ryan 2018 auf der Longlist des Man Booker Prize stand, sogar irgendwann noch einmal, denn so manches habe ich beim ersten Lesen garantiert übersehen.
Donal Ryan: Die Stille des Meeres. Aus dem Englischen von Anna-Nina Kroll. Diogenes 2021
www.diogenes.ch
Weitere Rezensionen zu Romanen von Donal Ryan auf diesem Blog: