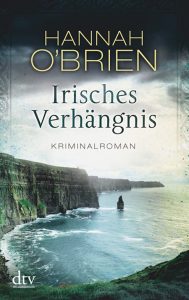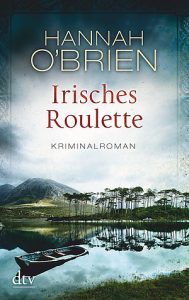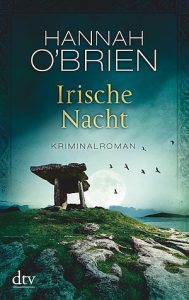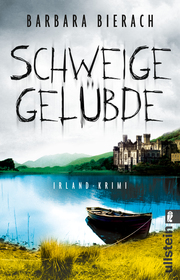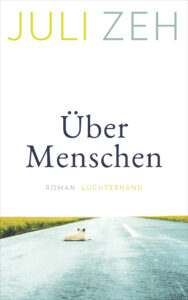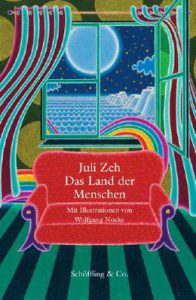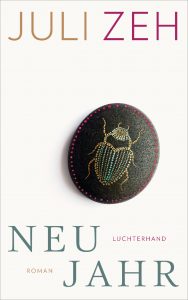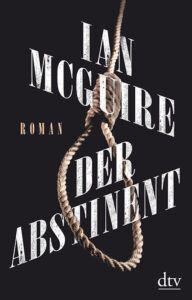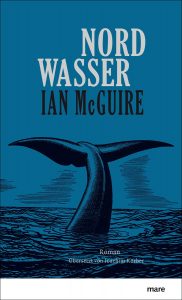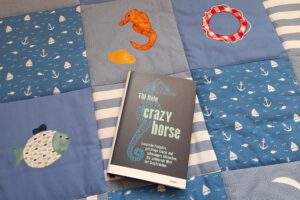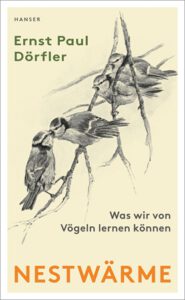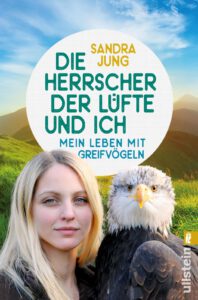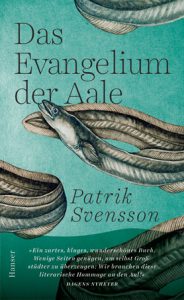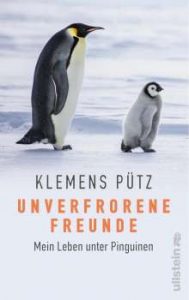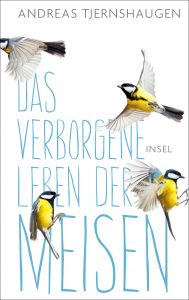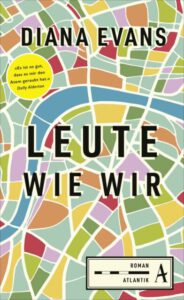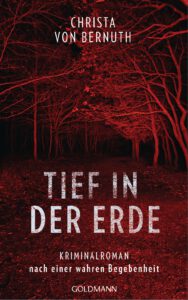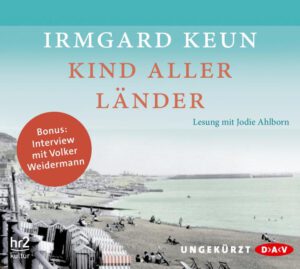Kann man eine unterbrochene Freundschaft neu beginnen?
Kann man eine unterbrochene Freundschaft neu beginnen?
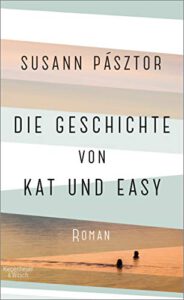
2018 wurde die 1957 geborene deutschsprachige Autorin Suzann Pásztor für ihren dritten Roman Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster mit dem Evangelischen Buchpreis ausgezeichnet. Nun ist Die Geschichte von Kat und Easy erschienen, ein Roman auf zwei Zeitebenen und einer Brücke in Form eines Kummerkasten-Blogs. Interessant ist die Wahl der Zeitformen und der Perspektive: Die Kapitel mit der Überschrift Laustedt spielen 1973 und sind in personaler Erzählform sowie im Präsens verfasst, in den mit Kreta überschriebenen Abschnitten aus der Jetzt-Zeit erzählt Kat in der Vergangenheitsform.
Vom Ende einer Freundschaft…
Das Jahr 1973 ist für die beiden Protagonistinnen Kat und Easy prägend und präsent bis in die Gegenwart. Damals wurden sie 16 und das autonome Jugendzentrum von Laustedt war plötzlich wichtiger als die Schule, sie wollten „mindestens zehnmal so glücklich wie unsere Mütter“ werden, Drogen, Alkohol und Sex zu erleben wurde zum wichtigsten Vorhaben. Trotz ihrer Verschiedenheit schien kein Blatt zwischen sie zu passen: Kat pummelig, mit dicker Brille und betont cool, Easy schön, anziehend, unbekümmert und keinem Flirt abgeneigt, Kat unter dem Eindruck der soeben vollzogenen Trennung der Eltern, Easy aus einem perfektionistischen Arzthaushalt mit strenger Moral.
Es hätte das geplante Superjahr werden können, wäre da nicht der 20-jährige Robert, genannt Fripp, gewesen, in den beide sich verliebten. Fripp, von dessen Tod man bereits auf den ersten Seiten erfährt, auch wenn die Umstände erst ganz zuletzt aufgeklärt werden. Dieser Verlust beendete nicht nur ihre Freundschaft, er überschattete auch ihr ganzes weiteres Leben.
… und von einem Neubeginn
Easy, mittlerweile 62, Mutter dreier erwachsener Kinder unterschiedlicher Väter, sucht über Kats Coaching-Blog Rat und Kontakt. Nach 46 Jahren Funkstille lädt sie die geschiedene, kinderlose Jugendfreundin in ihr renovierungsbedürftiges Häuschen auf Kreta ein. Endlich soll auf den Tisch kommen, was so lang verschwiegen wurde. Und weil das von Angesicht zu Angesicht nicht einfach ist, geht das Zwiegespräch über den Blog weiter – bis Kat kurz vor ihrem Abflug doch noch den schmerzhaftesten Punkt der Geschichte beichtet.
Für mich kein sehr nachhaltiges Leseerlebnis
So gut die Idee des Romans und die versetzte Erzählweise sind, so wenig bin ich mit den beiden Protagonistinnen, insbesondere Easy, warm geworden, schon gar nicht mit dem verantwortungslosen Fripp. Während der Grund für Kats dauerhafte Verwundung nachvollziehbar ist, sie zwar andere beraten, sich selbst dagegen nicht helfen kann, hat sich mir Easys Trauma rückblickend nicht wirklich erschlossen. Auch der Konsum unterschiedlichster Drogen ist mir viel zu ausufernd geschildert und in der Jetzt-Zeit auf Kreta wenig glaubhaft bis ärgerlich. Ich vermisse auch eine spürbare Weiterentwicklung der Figuren, die Easy in ihrem letzten Post als „Ich-wills-wissen“ an die Lebensberaterin „Mockingbird“ alias Kat so auf den Punkt bringt:
Wir waren jung damals, aber wir waren trotzdem längst die, die wir heute sind. Das ist erschreckend und tröstlich zugleich, oder? (S. 267)
In die Atmosphäre der 1970er-Jahre mit den entsprechenden Musiktiteln und den Problemen der Heranwachsenden konnte ich mich – bis auf die Drogenexperimente – hineinversetzen. So gepackt, dass ich unbedingt erfahren wollte, was im Herbst 1973 tatsächlich geschah, hat es mich aber leider nicht.
Susann Pásztor: Die Geschichte von Kat und Easy. Kiepenheuer & Witsch 2021
www.kiwi-verlag.de

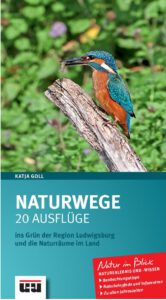 Unter den zahlreichen Einschränkungen durch die Coronapandemie erscheinen vielen die fehlenden Reisemöglichkeiten besonders hart. Nicht nur die Touristikunternehmen, auch die Reisebuchverlage beklagen große Einbußen. Regionale Reiseführer für die nähere Umgebung sind dagegen gefragt, das „Mikro-Abenteuer“ vor der eigenen Haustür boomt.
Unter den zahlreichen Einschränkungen durch die Coronapandemie erscheinen vielen die fehlenden Reisemöglichkeiten besonders hart. Nicht nur die Touristikunternehmen, auch die Reisebuchverlage beklagen große Einbußen. Regionale Reiseführer für die nähere Umgebung sind dagegen gefragt, das „Mikro-Abenteuer“ vor der eigenen Haustür boomt.
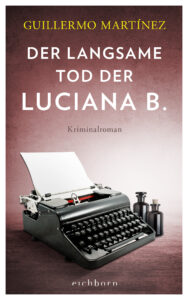
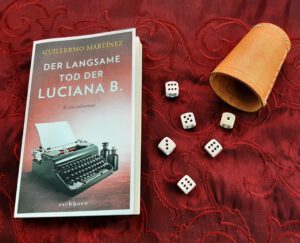
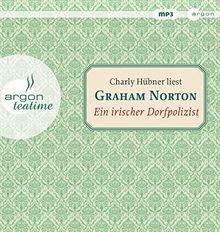 Im südirischen Dorf Duneen scheint die Zeit nicht zu vergehen, sie versickert. Der aus Limerick zugezogene Dorfpolizist Sergeant Patrick James Collins hat es seit 15 Jahren hauptsächlich mit der Regelung des Verkehrs zu tun. Das ist gut so, denn angesichts seiner Korpulenz scheint PJ, wie er genannt wird, nicht für die Verbrecherjagd prädestiniert.
Im südirischen Dorf Duneen scheint die Zeit nicht zu vergehen, sie versickert. Der aus Limerick zugezogene Dorfpolizist Sergeant Patrick James Collins hat es seit 15 Jahren hauptsächlich mit der Regelung des Verkehrs zu tun. Das ist gut so, denn angesichts seiner Korpulenz scheint PJ, wie er genannt wird, nicht für die Verbrecherjagd prädestiniert.